Eine gerechte gedeihliche Entwicklung f0r alle ist möglich – hier und heute
Eine gerechte gedeihliche Entwicklung für alle ist möglich – hier und heute
Nicht die Realwirtschaft, sondern falsche Theorien verhindern echte wirtschaftliche Entwicklung
Interview mit Professor Richard A. Werner
ev. Nach der letzten grossen Finanzkrise um 2008 setzte zunächst eine Diskussion und ein Nachdenken über wirtschafts- und finanzpolitische Zusammenhänge ein, das Hoffnung weckte – Hoffnung auf eine Emanzipation von (pseudo-)ökonomischen Glaubenssätzen, welche die letzten Jahrzehnte dominiert hatten. Statt zu einer Besserung hatten diese ja immer wieder zum Gegenteil geführt. Dennoch wurde das Mantra der neoliberalen Wirtschaft – Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung und generelle Marktöffnung – mit eiserner Faust durchgesetzt. Der Glaube an angeblich notwendige Kredite bildete dabei den zentralen Hebel zur Durchsetzung dieser Ideologie. Und obwohl sie dort, wo sie zur Anwendung kam – in den ehemaligen kommunistischen Ländern oder in Entwicklungsländern, aber auch in Europa – zu Staatsverschuldung und Abhängigkeit, zum Ausverkauf der regionalen Wirtschaft und zu vermehrter sozialer Ungleichheit geführt und die Zahl der Bank- und Finanzkrisen nicht ab-, sondern zugenommen hat, bleibt sie bislang offizielles Credo – auch wenn zunehmend mehr Ökonomen Zweifel an ihr hegen.
Im Rahmen des Rhodes Forum 2015* moderierte Professor Richard A. Werner eine Plenarsitzung zum Thema «Eine gemeinsame gedeihliche Zukunft: Finanz- und Wirtschaftspolitik für eine gerechte Entwicklung für alle». In seinem einführenden Referat legte er in kurzen Zügen dar, dass die heute vorherrschende Wirtschaftstheorie des sogenannten freien Marktes – bekannt als neoliberale oder neoklassische Theorie, Chicago School of Economics – verschiedene ökonomische Probleme nicht zu erklären vermag. Vielmehr geht sie von falschen Axiomen aus – in seinem Buch «Neue Wirtschaftspolitik. Was Europa aus Japans Fehlern lernen kann» setzt sich Richard Werner damit ausführlich auseinander 1 –, und aus diesen Vorannahmen, die einer empirischen Prüfung an der Realität nicht standhalten, werden in rein deduktiver Ableitung alle weiteren, entsprechend falschen Schlussfolgerungen abgeleitet. Mit anderen Worten: Die gesamte Theorie der freien Märkte, der Wirkung von Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung bricht in sich zusammen, wenn sich zeigt, dass die zugrundeliegenden Axiome und Bedingungen mit der Lebensrealität des Menschen und der Wirtschaft nicht vereinbar sind. Was nicht zuletzt auch ein Blick in die Geschichte dokumentiert.
Für Richard Werner ist dabei ein weiterer Aspekt besonders interessant: Kaum eine der vorherrschenden ökonomischen Theorien bezieht den Vorgang der Geldschöpfung adäquat mit ein, und auch die Rolle der Banken wird nicht realistisch abgebildet. Dies ist, wie das nachfolgende Interview zeigt, vor allem für die Entwicklungsländer von entscheidender Bedeutung: Fasst man den Mechanismus der Geldschöpfung und die besondere Rolle und Position der Banken adäquater ins Auge, eröffnet das neue Perspektiven für Wachstum und (volks-)wirtschaftliches Vorankommen.
Werner, der den Begriff des «Quantitative easing», der quantitativen Lockerung, 1994 ursprünglich prägte, weist darauf hin, dass nicht die Geld- beziehungsweise Kreditschöpfung für sich allein genommen ein Problem darstellt, solange man sie zum Wohle der Völker nutzt und in die produktive Industrie leitet, in der durch menschliche Arbeit und Kreativität Wertschöpfung betrieben und damit Entwicklung ermöglicht wird. Dies allerdings erfordert eine volkswirtschaftlich orientierte Geld- und Wirtschaftspolitik, die primär an der Entwicklung vor Ort orientiert ist und deren Schutz verpflichtet sein müsste – entsprechend kritisiert Richard Werner auch die Zentralisierung und Monopolisierung des Geldwesens in mächtigen Zentralbanken, allen voran der Federal Reserve, der Bank von England (und ihrer Heimat, der City of London) und der EZB, welche die Quantitative Lockerung völlig konträr zum ursprünglichen Konzept anwenden und das Geld nicht in die Realwirtschaft, sondern zu grossen Teilen in die Finanzindustrie leiten.

Richard A. Werner ist ein deutscher Wirtschaftswissenschafter und Professor für Internationales Bankwesen. 1989 Hochschulabschluss der London School of Economics in Volkswirtschaftslehre mit First Class Honours; Doktorat in Volkswirtschaftslehre (zu Wirtschaft und Bankwesen in Japan) an der Oxford University; ab 1990 Studien im Rahmen des Graduiertenprogramms an der Universität Tokio mit Studien am Forschungsinstitut für Kapitalbildung der Japanischen Entwicklungsbank, Gastwissenschafter am Institut für Geld- und Wirtschaftsentwicklung der Zentralbank und Gastdozent am Institute for Monetary and Fiscal Studies beim Finanzministerium in Tokio. Weitere Tätigkeiten in Japan und bei der asiatischen Entwicklungsbank sowie als Chefökonom der britischen Investmentbank Jardine Fleming Securities (Asia) Ltd. Seine Studien zu den Hintergründen der japanischen Krise publizierte er unter anderem 2001 im Buch «Princes of the Yen», das in Japan auf Platz 1 der Bestsellerliste gelangte.
2004 folgte Werner einem Ruf an die Universität Southampton, Grossbritannien. Dort ist er derzeit Professor für Internationales Bankwesen und Direktor der Abteilung für Internationale Entwicklung sowie (Gründungs-)Direktor des Centre for Banking, Finance and Sustainable Development; fünf Semester lehrte er Volkswirtschaftslehre als Vertretungsprofessor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main.
Richard Werner ist ausserdem Gründungsmitglied und Vorstand von Local First Community Interest Company, einem gemeinnützigen Unternehmen, das auch in Grossbritannien Lokalbanken nach dem Vorbild deutscher Genossenschaftsbanken und Sparkassen einführen will.
Zeit-Fragen: In Ihrem Referat haben Sie darauf hingewiesen, dass man den Entwicklungsländern im Zuge der Entkolonialisierung ein bestimmtes Wirtschaftsmodell aufgedrängt hat, um sie trotzdem weiter unter Kontrolle zu halten. Welches sind Ihre Kritikpunkte an diesem Modell?
Professor Richard A. Werner: Ich habe im Referat nur drei Punkte aufgegriffen. Zunächst, dass diesen Ländern gesagt wird: «Ihr wollt wachsen, euch entwickeln. Was braucht man da? Man braucht Ersparnisse. Aber ihr habt nicht genug Ersparnisse in den Entwicklungsländern. Tja, da können wir euch helfen. Ihr könnt euch das ausleihen von unseren Banken.» Das Modell von Keynes aus dem Jahr 1936 sagt eben, man brauche erst Ersparnisse – übrigens hat Keynes da seine Ansicht um 180 Grad geändert, denn früher hatte er gesagt, das gehe durch Kredite, aber in der Theorie von 1936 sagt er: Nein, man braucht erst Ersparnisse, und spricht nicht mehr von Krediten. Ich weiss nicht, was dazwischen passiert ist, aber es kommt oft vor, dass Ökonomen ihre Meinung ändern und dann nie wieder von der früheren sprechen.
Jedenfalls haben die Ökonomen Harrod und Domar dieses neuere Argument von Keynes nach dem Krieg für ihr Modell des wirtschaftlichen Wachstums verwendet, und dieses wurde sehr einflussreich in den Entwicklungsländern. Es wurde dann vom IWF, der Weltbank sowie den Entwicklungsbanken vertreten und schliesslich de facto weltweit eingeführt. Und da heisst es eben: Die Entwicklungsländer können sich das zum Wachstum notwendige und daheim nicht vorhandene Geld vom Ausland ausleihen. Da kamen natürlich die internationalen Banken und haben es ihnen geliehen. Die Realität aber ist ganz anders: Erstens stimmt es nicht, man braucht diese Ersparnisse nicht zum Wachstum, denn man kann sich das Geld durch einheimische Kreditschöpfung erzeugen.
Die Täuschung mit den Auslandskrediten
Wenn man eine eigene Währung hat …
Ja natürlich, genau. Aber das war ja auch der Fall. Die meisten hatten ihre eigene Währung, ihre eigenen Banken und Zentralbanken, die können also das Geld selber schöpfen und müssen sich nichts aus dem Ausland leihen. Denn zweitens braucht man schon gar kein ausländisches Geld, da es nämlich der einheimischen Wirtschaft gar nicht helfen kann. Diese Auslandskredite wurden von den internationalen Banken ja fast immer in ausländischer Währung vergeben. Die Währungen der Entwicklungsländer – Singer/Prebisch haben das gezeigt – fallen über längere Zeiträume, wie 50 bis 100 Jahre, und daher werden die Schulden der Entwicklungsländer, wenn sie sich im Ausland in ausländischer Währung verschuldet hatten, natürlich immer grösser. In dieser Schuldenfalle ist man schnell drinnen, und dann heisst es: «Tja, jetzt müssen wir einen ‹Debt for Equity Swap›2 machen, denn ihr könnt eure Schulden ja nicht mehr bezahlen. Jetzt kriegen wir halt eure Ländereien und eure Bodenschätze und so weiter.» So wird das arrangiert. Dabei könnten die Länder ja erstens das Geld selber erzeugen, brauchen also keine ausländischen Kredite. Und zweitens: Die ausländischen Kredite dieser internationalen Banken – wo kommen die denn her? Die internationalen Banken erzeugen die auch nur aus dem Nichts. Und, noch schöner: Das ausländische Geld kommt gar nicht ins Land herein. Denn die Dollar, Pfund und Euro, die von den ausländischen Banken erzeugt werden, – da sieht man ganz klar – die ausländischen Gelder bleiben im ausländischen Bankensystem. Das heisst, die britischen Pfund bleiben im britischen Bankensystem, die Schweizer Franken bei den Schweizer Banken und so weiter. Da kommt nichts davon rein in die Entwicklungsländer. Das Ganze ist also nur ein Trick, eine Täuschung. Und wenn man das weiterverfolgt, in dem Moment, wo die Kredite, die Dollars zum Beispiel, umgewandelt werden, in südafrikanische Rand oder irgendwas, in dem Moment findet dann im südafrikanischen Bankensystem, also im Bankensystem des Kreditnehmers, die Kreditschöpfung statt. Aber die kann ja auch durchgeführt werden ohne diesen Auslandskredit.
Also eine grosse Täuschung, der Transfer.
Ja. So und so müssen die Kredite ja gedeckt sein durch die Abzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers. Das ist immer der Fall. Das kann man ohne Auslandskredite auch haben.
Das ist im Prinzip das Gleiche, was man heute Griechenland empfehlen müsste.
Ja natürlich, es ist immer das Gleiche.
«Die heutige Makroökonomie ist mehr Fiktion als Realität.» (Neue Wirtschaftspolitik, S. VIII)
Einheimische Kreditschöpfung – gegen Auslandsverschuldung und Deflation
Das heisst, wenn sie eine Zentralbank hätten und eine eigene Währung, könnten sie sich das selber schöpfen.
Ich hatte dem Finanzministerium in Griechenland auch gesagt, sie sollen keine Staatsanleihen mehr ausgeben und sich die Kredite von den einheimischen griechischen Banken nehmen. Damit würden sie gleichzeitig mehrere Probleme lösen, denn die Banken müssen auch wachsen – die schrumpfen ja, und solange sie schrumpfen, ist es deflationär für die Wirtschaft, da kann kein Wachstum stattfinden –, und damit hätten sie einheimische Kreditschöpfung. Im Gegensatz zu Staatsanleihen werden Bankkredite nicht zum Marktwert bewertet. Weil aber die zur Finanzierung tatsächlich verwendeten Staatsanleihen ja ständig zum Marktwert bewertet werden, ist man immer diesen Angriffen der Anleihenspekulanten ausgeliefert – und damit erpressen sie ja Griechenland. Mit Kreditnahme des Staates von den einheimischen Banken – was ich «Enhanced Debt Management» nenne – wäre man ganz raus aus der Auslandsverschuldung und könnte tatsächlich auch in der Euro-Zone eine Deflation vermeiden. Während der Zins im Markt für Anleihen auf hohe zweistellige Prozente hochgetrieben wurde, ist der Zins im Bankkreditmarkt unter 3 Prozent geblieben. Es ist also schwer zu verstehen, warum die Finanzministerien der Länder wie Griechenland, Irland, Portugal und Spanien überhaupt weiterhin Anleihen ausgaben und sich nicht einfach den viel billigeren Kredit von den eigenen Banken nahmen. Ich habe das oft in ganz Europa vorgetragen, einschliesslich vor Vertretern von allen Finanzministerien der EU (das war in Brüssel im Januar 2012). Anscheinend hat man das da und dort auch verstanden. Aber dann wurde mir von bestimmten Finanzministerien mitgeteilt: «Das dürfen wir nicht, das erlaubt uns die EZB nicht.» Aber rein rechtlich kann die EZB das nicht verhindern. Die Iren zum Beispiel hätten das einfach machen sollen, aber sie befanden sich da sehr unter Druck, und es waren vielleicht auch die falschen Leute in den jeweiligen Entscheidungspositionen. Das jedenfalls ist der erste Punkt.
Dann hätte ich auch noch zwei andere Punkte: Das Mantra der Wirtschaftspolitik aus Washington sagt auch, man brauche Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung; nur dann gäbe es Wirtschaftswachstum. Dazu kann man verschiedene Gegenbeispiele nennen. Gegenbeispiele sind eigentlich alle Länder, die sich erfolgreich entwickelt haben: Die haben das alle auf Grund strategischer Intervention der Regierung und durch Industriepolitik geschafft. Es gibt kein Land, das auf Grund einer Politik des freien Marktes zur Wirtschaftsmacht wurde. Ob das jetzt Grossbritannien ist, Amerika, Deutschland oder Japan und Ostasien …
«Geschichte ist die Datenbank der ökonomischen Realität»3
Sie meinen den Zeitpunkt, zu dem diese Länder sich entwickelt haben …
Ja, in Grossbritannien fing das ja schon im 17. und 18. Jahrhundert an, mit der Industrialisierung in der Textilindustrie. Aber warum war die Textilindustrie überhaupt schon entwickelt und wichtig? Das haben die Briten nur durch Industriepolitik geschafft. Früher, im 13./14. Jahrhundert, hat England nur Rohwolle exportiert, keine Fertigprodukte. Dann haben die Herrscher verstanden, dass man durch den Export von Produkten mit niedrigem Wert abhängig wird von den Ländern, die die Produkte mit hohem Mehrwert produzieren. Die englischen Könige wurden erst hochverschuldet gegenüber der Hanse, bevor sie dies verstanden. Sie mussten sogar die Kronjuwelen an die Hanse verpfänden. Dann haben sie gemerkt: Wir müssen Wertschöpfung in England betreiben und uns auf Produkte mit hohem Mehrwert spezalisieren. Dazu war Industriepolitik nötig. Durch die dann eingeführte Industriepolitik, welche konsequent die Textilindustrie aufbaute, hat sich England dann rapide entwickelt.
«Eine realistische Beschreibung der Volkswirtschaft mag zwar politisch wenig attraktiv erscheinen. Aber in der volkswirtschaftlichen Forschung, wie in der Naturwissenschaft, ist es wissenschaftlich, die Realität anzuerkennen. Die Rhetorik der Märkte verhindert die Anerkennung der Tatsachen. Nur eine realitätsnahe Ökonomie hat eine Chance, zur Lösung der Probleme unserer Welt beizutragen. Denn diese Probleme können meist tatsächlich gelöst werden.» (Neue Wirtschaftspolitik, S. IX)
Das hat sich über einige Zeit entwickelt?
Ja. Das hat sich über mehr als hundert Jahre hingezogen. Aber es war klare Industriepolitik. Anfangs wurden zum Beispiel Gesetze eingeführt, die bestimmten, dass man keine rohe Wolle mehr exportieren durfte. Dann gab es staatliche Förderung für Exporte von Produkten mit hohem Mehrwert und auch für Importe von Rohmaterialien mit niedrigem Mehrwert. Die Engländer haben sich dann die Technologie geholt, dadurch dass sie die Flamen ins Land holten, die als «Flemings» in England angesiedelt wurden und deren Know-how dann assimiliert wurde. Dann gab es Gesetze, dass zum Beispiel alle Toten mit Wollkappen begraben werden mussten, um die Wollnachfrage der einheimischen Produktion zu steigern. Ausländische Wolle war ganz verboten. So wurde eine Industrie – die Textilindustrie, die Wolle verarbeitete – aus dem Nichts gestampft.
Zweitens baute England eine eigene Flotte auf. Zuvor hatte man in England keine Schiffe im Staatsbesitz. Danach hatte man die grösste Flotte der Welt. Aber auch da hatte die Regierung durch Gesetze die nötigen Eingriffe vorgenommen. Zum Beispiel war es verboten, dass ausländische Schiffe an englischen Häfen Waren hin und her transportieren durften. Vorher waren das hauptsächlich ausländische Schiffe. Das durften dann nur noch englische Schiffe machen. Das hat dann auch die ganze Schiffsproduktion erhöht und so weiter. Friedrich List beschreibt das sehr gut.
Man betrieb also sowohl einheimische Industriepolitik als auch internationale, man erliess Handelsrestriktionen, um die neuen Industrien zu schützen. Dazu gibt es zahlreiche Gegenbeispiele: Länder, die bewusst den Freihandel nicht erlaubt haben, wurden erfolgreich, während Länder, die unter IWF-Anleitung den Freihandel eingeführt haben – in Afrika zum Beispiel –, an einer sich verschlechternden einheimischen Wirtschaft litten, die durch ausländische Waren von der internationalen Konkurrenz kaputtgemacht wurde. Das Land verarmt und wird immer mehr verschuldet – das geht dann nur noch bergab.
Wo sehen Sie Alternativen für die Länder, um aus diesem Teufelskreis auszubrechen?
TTIP sollte man auf keinen Fall unterschreiben. Man sollte seine Souveränität beibehalten. Dann wird man natürlich auch unter Druck gesetzt, und daher muss man sich seinen eigenen Wirtschaftsblock suchen. So machen das eben die BRICS-Länder – die werden ja eh von TTIP ausgeschlossen. Unter dem Vorwand des Freihandels bildet sich ja eigentlich ein Handelsblock, der sich dann den anderen gegenüber wieder abschottet.
Die Bedeutung einer souveränen Volkswirtschaftspolitik
Ganz klar …
Und daher müssen die anderen Länder sich organisieren. Russland, Indien, China, Brasilien und so weiter, die machen das ja. Die wollen auch nicht erpressbar sein im Zahlungssystem und entwickeln ihr eigenes Zahlungssystem. Das ist natürlich nötig.
Dann ist es gleichzeitig für jedes Land wichtig, dass man Autarkie möglichst beibehält, sonst ist man erpressbar. Wenn die Wirtschaft autark ist, können andere Länder ruhig drohen: «Wir handeln mit euch nicht!» – Okay, dann halt nicht. Solange man die wichtigen Güter selber erzeugt oder von Partnern beziehen kann, mit denen man Handel betreiben kann, dann geht das. Wichtig ist, das Gewicht auf die lokale und regionale Wirtschaft zu legen, dann geht das. Und am besten durch dezentralisierte Geldschöpfung in Regionalbanken; damit ist dann die Region wirtschaftlich sehr unabhängig.
Was Sie sagen, entspricht ganz den Schlussfolgerungen des Welt-Agrarberichts, der ja auch empfiehlt, die lokale und regionale Wirtschaft aufzubauen.
Genau.
«Die enorme ökonomische Leistungskraft Chinas, Japans und anderer Länder des Fernen Ostens ist nicht auf freie Märkte zurückzuführen, auch nicht auf Kampagnen zur Liberalisierung oder zur Deregulierung, so wie sie von der neoklassischen Ökonomie vertreten wurden.» (Neue Wirtschaftspolitik, S. 7)
Und die Regionalbanken schöpfen dann ihr eigenes Geld …
Natürlich.
Und sind unabhängig. Man müsste also die regionalen kleinen Banken fördern …
So wurde das in Deutschland in der Vergangenheit gemacht. In Deutschland gibt es 1500 kleine Kommunalbanken, und die erzeugen fast die ganze Geldmenge in Deutschland. Die wird durch Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen vergeben. Dadurch ist der Mittelstand so stark. Das ist dank dieser regionalen kleinen Banken, der Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen möglich. Die sind ja alle unabhängig, das sind ja einzelne Banken, zwar unter dem gleichen Label «Sparkasse» oder «Volksbank», aber die sind rechtlich separat und treffen ihre eigenen Entscheidungen, und das ist auch richtig so. Früher hatte jedes Dorf, jeder Ort, seine eigenen Banken, oft sogar drei: eine Sparkasse, eine Raiffeisenbank und eine Volksbank. Die Aufsichtsbehörden, insbesondere der EU, haben in den letzten 20 Jahren viel Druck auf diese guten Lokalbanken ausgeübt, um sie zum Aufgeben zu zwingen. Daher gab es seither viele Fusionen. Heute gibt es meist nur noch zwei Banken, und das nur noch in den Städten oder Märkten.
Regionalbanken fördern Wirtschaftswachstum und Finanzstabilität
Das wollte ich Sie gerade fragen. Wir erleben in der Schweiz gerade einen Niedergang vieler kleiner Banken …
Ja, ja. Die Schweizer Nationalbank und mehr noch die Europäische Zentralbank (EZB) haben ihre Geldpolitik so gesetzt, dass diese kleinen Banken zerstört werden, weil das noch die letzte Bastion der alternativen Wirtschaft ist in der Schweiz und in Deutschland. Das soll zerstört werden. Wir versuchen da jetzt dagegenzuhalten, indem wir diese Community Banks in England einführen. Wir wollen ein Netzwerk von Kommunalbanken bilden. Davon ist die Bank of England nicht begeistert, obwohl es nachweislich förderlich ist für Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und Finanzstabilität.
In Deutschland werden die kleinen Banken duch die EZB und die EU regelrecht kaputtgemacht, durch deren viele neuen aufsichtlichen Auflagen und Regularien. Selbst kleinste Banken mit nur zehn Angestellten müssen nun so detailliert berichten wie eine Deutsche Bank, die dafür allein 1000 Fachleute anstellt. Die Kleinbanken müssen dann mehrere Leute einstellen, die nur damit beschäftigt sind, Berichte an die Behörden zu schreiben. Die können sich das gar nicht leisten. Da ist jede Stelle wichtig, und wenn man plötzlich zwei Leute für solche Arbeiten zur Verfügung stellen muss, dann muss man die Bank zumachen.
Und die andere Methode, die Kommunalbanken kaputtzumachen, ist natürlich die Zinspolitik. Kurzfristige Zinsen sind auf Null herabgesetzt worden. Durch die sogenannte quantitative Lockerung der Anleihenkäufe sind auch die langfristigen Zinsen auf Null gesenkt worden. Daher ist die Zinskurve flach, um Null – da gehen die echten Banken, die produktive Kredite an kleine Firmen vergeben, kaputt. Und welche Banken überleben? Die Spekulationsbanken, die ihr Geld in Finanzmärkte pumpen, denn durch die Niedrigzinspolitik wird wieder Inflation der Wertpapiere erzeugt.
Die Politik, nur noch Grossbanken überleben zu lassen, betreibt seit über hundert Jahren die City of London. Und wer ist jetzt der EU-Finanzkommissar? Ein City-of-London-Lobbyist, der in Brüssel nun auch offiziell die Gesetze schreibt. Da wird der Bock zum Gärtner gemacht.
Wenn Sie sagen, dass Sie in England, in Hamsphire, solche Banken aufbauen, haben Sie sicher Ideen, wie man solche kleinen Banken über die Runden bringen kann. Das wäre ja wichtig, für alle anderen Kleinbanken.
Neue Ideen haben wir nicht: Wir wollen die alten umsetzen! Oder anders gesagt, die neue Idee ist, zurückzukehren zu den Ursprüngen der genossenschaftlichen Banken, als diese vor 150 Jahren überall gegründet wurden. Bezüglich dieser Regularien wollen wir versuchen, uns mit anderen Banken zusammenzutun, um die abzudecken. In Deutschland macht man diese Dinge ja auch im Verbund. Aber es bleibt weiterhin schwierig. Hier ist es wichtig, die Politik einzuschalten und in der Öffentlichkeit eine Gleichbehandlung mit Amerika zu verlangen: In den USA haben die Kleinbanken ihre eigene Aufsicht, mit viel leichteren Auflagen als die der Grossbanken. Die EU und EZB haben sich bisher geweigert, wahrscheinlich auf Anordnung der USA, derartige Gleichbehandlung der Kleinbanken in Europa mit den Kleinbanken in den USA zuzulassen.
«Die Geldpolitik ist die wirksamste Gestaltungskraft bei der Durchsetzung makroökonomischer Ziele. Denn sie beeinflusst nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern vermag auch gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Wegen der ungeheuren Macht und Tragweite der Geldpolitik, die es erlaubt, die volkswirtschaftlichen Ressourcen zu kontrollieren und zu lenken, sollte sie einer Institution anvertraut sein, die fest verankert ist im demokratischen Prozess […].» (Neue Wirtschaftspolitik, S. 451)
Aber man versucht es.
Ja. Aber wenn solche Kommunalbanken auch in England existieren, könnte sich politisch damit auch etwas ändern. Die City of London könnte dann nicht mehr so argumentieren: Ach, das sind ja so deutsche Ausreden, ihr wollt eine spezielle Behandlung – so wird das halt immer gesagt. Aber dann gibt es ja auch in England Kommunalbanken. Das könnte auch helfen in dieser Debatte.
Herr Professor Werner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. •
(Interview Erika Vögeli)
* Rhodes Forum 2015: Vom 8. bis 11. Oktober 2015 fand der Jahreskongress des World Public Forum «Dialog der Zivilisationen» zum Thema «Die Welt jenseits des globalen Chaos» auf Rhodos, Griechenland statt. Das World Public Forum oder Forum der Weltöffentlichkeit versteht sich als Teil der praktischen Umsetzung der Resolution «Globale Agenda für den Dialog unter den Zivilisationen» der Uno-Generalversammlung vom 9. November 2001. 2002 in Russland initiiert, findet seit 2003 jährlich ein Treffen auf Rhodos statt, um Dialog, Austausch und Verständnis unter den Zivilisationen zu fördern und friedliche, gewaltlose Lösungen im Sinne einer menschlichen Zukunft für alle zu suchen.
1 Werner, Richard A. Neue Wirtschaftspolitik. Was Europa aus Japans Fehlern lernen kann. München 2007. (ISBN 978-3-8006-3247-3)
2 Debt-for-Equity Swap: Abgeltung einer Forderung, indem der Gläubiger Beteiligungen am Unternehmen des Schuldners erhält – in Falle der Entwicklungsländer als Beteiligungen an den Ressourcen wie beispielsweise Land und Bodenschätze eines Staates.
3 Werner, Richard A. Neue Wirtschaftspolitik, S. X
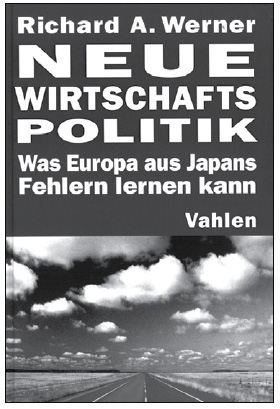
«Die Kritiker der neoklassischen Ökonomie sind sich darin einig: Die Wirtschaftswissenschaften haben sich mit der Wirklichkeit zu befassen; sie müssen den Nachweis erbringen, dass sie taugliche Werkzeuge im Umgang mit den Realien des Wirtschaftslebens sind. Dem Laien muss dies selbstverständlich erscheinen. Der immer noch vorherrschenden Hauptströmung des ökonomischen Denkens stellt sich dies ganz anders dar. Die neoklassische Schule gründet auf einer deduktiven Vorgehensweise. Nach dieser Methodenlehre gelangen wir zu gültigen Erkenntnissen, indem wir Axiome als Ausgangspunkte unserer Suche wählen, die eben nicht aus empirischen Befunden gewonnen werden. Diese werden um theoretische Annahmen ergänzt, die wiederum einer empirischen Grundlage entbehren. Mit logischen Hilfsmitteln, insbesondere der Mathematik, werden aus den Axiomen und einem Überbau theoretischer Annahmen Schlussfolgerungen gezogen, die freilich wiederum rein theoretische Resultate hervorbringen.»
(Werner, Richard A. Neue Wirtschaftspolitik, 2007, S. 22, ISBN 978 3 8006 3247 3)