Die Quadratur des Kreises
Die Quadratur des Kreises

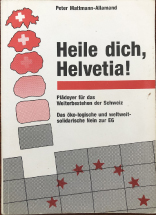
Sommersession – am 14. Juni im Ständerat / am 20. Juni im Nationalrat
Parlamentskommissionen fordern Zusatzverhandlungen zum Rahmenabkommen mit der EU
von Dr. iur. Marianne Wüthrich
Bisher versuchte der Bundesrat mit seiner «internen Konsultation» unter den «wichtigsten Akteuren» eine offene und ehrliche Diskussion mit der Bevölkerung über das aus Brüssel geforderte Rahmenabkommen zu verhindern. Nun schalten sich erfreulicherweise die Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Stände- und des Nationalrates ein und reichen ihrem jeweiligen Rat eine Motion ein, um die grössten Knackpunkte auf den Tisch zu bringen. Der Bundesrat wird dazu aufgefordert, das Institutionelle Abkommen mit der EU in Zusatzverhandlungen «zu verbessern».
Der Haken an der Angelegenheit: Die EU-Gremien werden kaum Interesse an Zusatzverhandlungen zu welchen Inhalten auch immer haben. Denn die EU will ja gerade deshalb das Rahmenabkommen durchdrücken, um ein für alle Mal die ewigen Diskussionen mit den unbotmässigen Schweizern zu erledigen. Mit dem Rahmenvertrag soll zu diesem Zweck ein Mechanismus eingeführt werden, der allein auf EU-Recht und EU-Gerichtsentscheiden beruht und keine Schweizer Sonderwünsche berücksichtigt.
Mit ihren Motionen versuchen unsere Parlamentarier also sozusagen eine Quadratur des Kreises: Sie fordern eine Diskussion über die Inhalte des Abkommens, die aus EU-Sicht gar nicht zur Debatte stehen. Für Brüssel gibt es nur ein Ja oder Nein zum ganzen Konstrukt, oder besser gesagt: Es gibt nur ein Ja. Dass ein derartiges Konstrukt nicht zur Schweizer Staatsstruktur passt (direkte Demokratie, Föderalismus, dezentrale und kleinräumige Organisation, Wahrung einer möglichst weitgehenden Souveränität), kommt in den beiden Motionen anschaulich zum Ausdruck.
Motion 19.3416 – Zusatzverhandlungen zum Institutionellen Abkommen mit der EU (eingereicht von der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-SR) am 9.4.2019 im Ständerat)
«Der Bundesrat wird beauftragt, mit der EU Zusatzverhandlungen zu führen oder andere geeignete Massnahmen zu ergreifen, um das Institutionelle Abkommen mit der EU wie folgt zu verbessern:
- Lohnschutz: Der Lohnschutz muss auf dem heutigen Stand sichergestellt und nach Bedarf weiterentwickelt werden können. Die Sozialpartner sind in die geforderten Nachbesserungen einzubeziehen.
- Unionsbürgerrichtlinie: Diese ist für die Schweiz nicht tragbar und muss explizit ausgeschlossen werden. Auch über im EuGH geführte Einzelprozesse darf diese nicht auf indirektem Weg für die Schweiz übernommen werden.
- Staatliche Beihilfen: Es ist sicherzustellen, dass die heutigen in der Schweiz bekannten Beihilfen nicht ausgeschlossen werden und der nötige Spielraum auch für die Zukunft erhalten bleibt.
- Anschlussgesetzgebung: Es ist sicherzustellen, dass die Schweizer Stimmberechtigen trotz dynamischer Rechtsübernahme weiterhin das letzte Wort haben. Entweder ist dies im Institutionellen Abkommen oder durch eine nationale Anschlussgesetzgebung sicherzustellen.
- Streitbeilegung: Es ist klar abzugrenzen, welche Tatbestände des geltenden und künftigen EU-Rechts zu einer Konsultation des EuGH durch das Schiedsgericht führen. Schweizer Gerichtsurteile dürfen nicht indirekt durch den EuGH aufgehoben werden können. Es ist eine periodische Berichterstattung über hängige Streitigkeiten und deren Beilegung vorzusehen. […]»
Motion 19.3420 – Zusatzverhandlungen zum Institutionellen Abkommen mit der EU (eingereicht von der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-NR) am 16.4.2019 im Nationalrat)
Die Motion der WAK-NR hat denselben Wortlaut wie diejenige der ständerätlichen Kommission, beschränkt sich aber auf die ersten drei Punkte (Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie, Staatliche Beihilfen).
Stellungnahme des Bundesrates: Kritik am Abkommensentwurf von vielen Seiten
In seiner Stellungnahme vom 22. Mai beantragt der Bundesrat zwar die Ablehnung der beiden Motionen: Ein Entscheid des Bundesrates über weitere Verhandlungen mit der EU sei verfrüht, weil die Auswertung seiner Konsultationen mit den parlamentarischen Kommissionen (WAK und APK), den Kantonen, Parteien und Sozialpartnern zum Abkommensentwurf noch im Gange sei.
Trotzdem merkt der Bundesrat an, dass die WAK beider Räte nicht die einzigen Kritiker der Inhalte des Abkommens sind: «Die in der Motion erwähnten Anliegen wurden auch von vielen anderen Teilnehmenden in den Konsultationen aufgebracht, insbesondere die Garantie des Lohnschutzes, die Frage der Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie sowie die Frage der Auswirkungen der Regelungen zu den staatlichen Beihilfen.»
Der Bundesrat selbst habe deshalb vorerst auf die Paraphierung des Abkommens verzichtet: «Insbesondere auf Grund offener Punkte in bezug auf die flankierenden Massnahmen (FLAM) und der Unionsbürgerrichtlinie (UBRL) […].»
Bekanntlich bestehen der Schweizerische Gewerkschaftsbund und die Sozialdemokratische Partei der Schweiz weiterhin auf den starken flankierenden Massnahmen, die sie seinerzeit als Bedingung für ihre Zustimmung zur Personenfreizügigkeit (Bilaterale I, Volksabstimmung vom 21.5.2000) gefordert hatten.1 Starker Widerstand kommt auch von den Kantonen gegen die zu erwartende massive Einschränkung der staatlichen (vor allem kantonalen und kommunalen) Beihilfen. Rechtsanwalt Simon Hirsbrunner, der die Kantone in bezug auf das Rahmenabkommen beraten hat, äussert in einem Radio-Interview unter anderem seine Befürchtung schwerwiegender Auswirkungen auf die kantonale Wirtschaftsförderung.2
Fazit
Auf die Debatten in beiden Räten über die zahlreichen umstrittenen Punkte und Unwägbarkeiten, die mit dem Rahmenabkommen über uns und unser Rechts- und Staatsverständnis hinwegbrausen würden, können wir gespannt sein. Aus einem Kreis kann man nun einmal kein Quadrat machen. Als Illustration dazu eine Stellungnahme von Gewerbeverbandsdirektor und Nationalrat Hans-Ulrich Bigler: «Es geht nicht um die Frage, ob die Anmeldefrist für ausländische Firmen von acht auf vier Tage gesenkt werden kann. Es geht darum, ob die Schweiz die Entsende- und Durchsetzungsrichtlinien der EU künftig dynamisch übernehmen muss. Das kommt weder für die Gewerkschaften noch für die Arbeitgeber in Frage.»3
Es ist zu hoffen, dass National- und Ständerat die Motionen dem Bundesrat überweisen werden. Was die EU-Kommission und der EU-Rat zu den Forderungen aus dem Parlament sagen werden, wird aufschlussreich sein. Warten wir doch gelassen ab. •
1 Siehe «Rahmenabkommen mit Brüssel oder Selbstbestimmung der Schweizerbürger?» in: <link internal-link seite:>Zeit-Fragen vom 28.8.2018
2 «Was genau steht im Rahmenabkommen?», SRF 4 News vom 13.12.2018. Interview mit Rechtsanwalt Simon Hirsbrunner: Oliver Washington. Niederschrift in: «Staatliche Wirtschaftsförderung wäre in Frage gestellt» in: <link internal-link seite:>Zeit-Fragen vom 3. Januar
3 «Dieses Resultat muss man weiterverhandeln.» Interview mit SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler. in: «Neue Zürcher Zeitung» vom 21. Januar; siehe dazu «Institutioneller Rahmenvertrag als Instrument des europäischen State-Building. Prominente Schweizer Stimmen zum Rahmenabkommen.» in: <link internal-link seite:>Zeit-Fragen vom 12. Februar