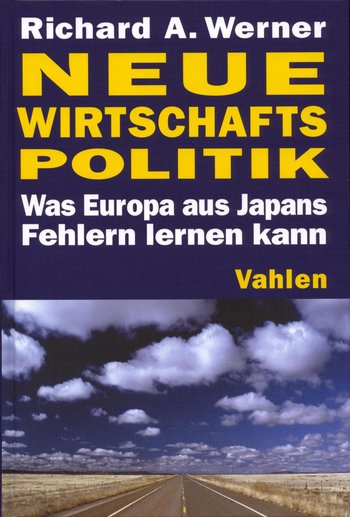«Nur eine realistische Ökonomie hat eine Chance, zur Lösung der Probleme unserer Welt beizutragen»
Zum Buch «Neue Wirtschaftspolitik» von Richard A. Werner
von Dieter Sprock
Wenn wir davon ausgehen, dass die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Welt nicht dem Plan eines wie auch immer gearteten Weltgeistes geschuldet, sondern menschengemacht sind, so erwächst uns daraus die Aufgabe, die Probleme anzugehen und nach Lösungen zu suchen. Der Ökonom Richard A. Werner leistet mit seinem bereits 2007 erschienenen Lehrbuch: «Neue Wirtschaftspolitik. Was Europa aus Japans Fehlern lernen kann» einen Beitrag dazu. Er untersucht darin, inwieweit eine verfehlte Volkswirtschaftslehre zur Entwicklung der wirtschaftlichen Missstände beigetragen hat, und fordert eine realistische Volkswirtschaftslehre, denn: Nur eine realistische Ökonomie habe eine Chance, zur Lösung der Probleme unserer Welt beizutragen.
Ich versuche in meinem Beitrag einige Befunde seiner Arbeit wiederzugeben, und zwar vor allem solche, die mir für ein besseres Verständnis wirtschaftlicher und politischer Abläufe heute wichtig erscheinen. Dabei bin ich mir bewusst, dass meine Auswahl nur einen kleinen Ausschnitt des sehr umfangreichen Materials wiedergibt, zumal ich auf die fachliche Diskussion der ökonomischen Theorien, die natürlich wesentlicher Bestandteil des Lehrbuchs sind, nicht eingehe.
Für Richard A. Werner steckt die Volkswirtschaftslehre in einer tiefen Krise. Die ihr zugrundeliegenden makroökonomischen Theorien, welche in vielen Ländern die Grundlage wirtschaftspolitischer Entscheidungen bilden, sind nach seiner Einschätzungen «mehr Fiktion als Realität». Ihr Credo, dass die «Wirkkraft freier Märkte» mit möglichst geringer staatlicher Intervention der beste Weg zu wirtschaftlicher Stabilität und Wohlstand sei, habe sich nicht bewahrheitet. Seit Jahrzehnten werde die neoliberale Überzeugung weltweit und besonders in den Entwicklungsländern und den ehemaligen kommunistischen Ländern umgesetzt, doch die erwarteten -positiven Resultate seien ausgeblieben: Armut, mangelnde soziale Sicherheit und wirtschaftliche Ungleichheit seien weiterhin ein grosses Problem für die Mehrheit der Menschen (S. VII).
Neoklassische Ökonomie
«Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung», so lautet das Credo der Denkschule, mit der sich Werner unter dem wenig geläufigen Namen «neoklassische Ökonomie» auseinandersetzt.
Nach neoklassischer Doktrin ermöglicht einzig der freie Markt «Wohlstand, eine florierende Wirtschaft und ein Maximum an persönlichem Glück». Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist, seien zu verkaufen. Der Arbeitsmarkt müsse «flexibler» werden. Was Entlassungen und grössere Unsicherheit für jene bedeutet, die noch Arbeit haben. Gefordert werden Reformen der Sozialversicherung und des Gesundheitswesens. Staatliche und gesellschaftliche Vorschriften und Eingriffe in den Kapital-, Güter- und Personenverkehr sollen weitestgehend abgebaut und die Regulierung aller wirtschaftlichen Aktivitäten solle einzig der «unsichtbaren Hand» des Marktes überlassen werden.
Bereits Mitte der 1980er Jahre seien die Debatten über wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fragen vom neoklassischen Gedankengut dominiert worden, «und zwar in all ihren Aspekten, ob sie nun die Rolle des Individuums betrafen, kommunale Belange, Firmen, den Staat oder gar die internationale Gemeinschaft» (S. 3). Die neoklassische Ökonomie fusst auf der Annahme, dass das «primäre Ziel und vorrangige Motiv der Menschheit die Mehrung des materiellen Wohlstands» ist. «Soziale Beziehungen und das Bedürfnis der Individuen, aufeinander einzugehen und in Gemeinschaft Anerkennung zu finden», solche Gesichtspunkte lägen ausserhalb des Gesichtsfeldes des neoklassischen Modells (S. 20).
In den 1990er Jahren sei der Einfluss der neoklassischen Denkschule allumfassend geworden. Die meisten wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge vermittelten ausschliesslich die Lehren der Neoklassik, und ihren Vertretern sei der Weg in die höchsten öffentlichen Ämter offengestanden: «Die neoklassische Ökonomie beherrschte die Entscheidungen der grossen internationalen Organisationen, die sich mit der Wirtschaftspolitik befassen. Darunter ragen insbesondere die regionalen Entwicklungsbanken, der IWF, die Weltbank, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die WTO (und ihre Vorgängerorganisation [GATT] sowie die OECD hervor.» In über einhundert Ländern haben «die Politik der Zentralbanken, die Strukturanpassungsprogramme, unter Federführung des IWF, sowie Reformpakete, welche von den Entwicklungsbanken geschnürt wurden, zu drastischen Veränderungen in der Fiskal- und Geldpolitik geführt». Und immer sei man dabei der neoklassischen Linie gefolgt – in der Regel mit Unterstützung des US-Finanzministeriums (S. 5).
Theorie und Wirklichkeit der Neoklassik am Beispiel Japans
Japan und andere Länder des Fernen Ostens bauten ihre Wirtschaft nicht auf der neoklassischen Theorie auf. Sie entwickelten eine Form des Kapitalismus, in der zwar Marktmechanismen einen gebührenden Platz innehatten, gleichzeitig aber auch gewährleistet war, dass nicht die Aktionäre, sondern die Gesellschaft als Ganzes Nutzniesser des Systems war. Sie orientierten sich an Theorien, die der «deutschen historischen Schule» oder der «sozialen Volkswirtschaftslehre» zuzuordnen seien.
Die japanische Nachkriegswirtschaft setzte bis Ende der 1980er Jahre auf eine Vielzahl von staatlichen Regelungen in Form staatlicher «Wirtschaftslenkung»: Die Kapitalmärkte waren beschränkt, die «Anteilseigner» hatten nur geringen Einfluss auf die Unternehmen der produktiven Wirtschaft, der Arbeitsmarkt war «inflexibel». Erwerbstätige in fester Anstellung genossen bei grossen Unternehmen eine lebenslange Arbeitsplatzgarantie. Ihr beruflicher Aufstieg richtete sich nach der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit, was zu einer grossen Loyalität der Angestellten gegenüber ihren Firmen führte. Und es gab eine grosse Zahl formeller und informeller «Kartelle»; gemeint sind hier Industrieverbände, bestehend aus zahlreichen Unternehmen, die durch langfristige Verträge und gegenseitiges Vertrauen miteinander verbunden waren, sowie in den 1950er und 1960er Jahren bis zu 1000 echte Kartelle, die «ausnahmsweise» genehmigt wurden.
Japan verzeichnete zwischen 1950 und 2000 eine durchschnittliche Wachstumsrate des realen Bruttosozialprodukts von 6,3 % (trotz zehn Jahren schwerer Rezession seit 1991); diese war nahezu doppelt so hoch wie jene der USA und fast dreimal so hoch wie jene Grossbritanniens (S. 127). Gemäss neoklassischer Theorie hätte die japanische Wirtschaft in diesem Zeitraum jedoch ein «Trümmerfeld» sein müssen.
Japan und andere grosse Volkswirtschaften Ostasiens hätten über Jahrzehnte ein hohes Wirtschaftswachstum erzielt, ohne von den «Vorzügen der freien Märkte» zu profitieren, während viele der «IWF-Musterschüler» in Afrika und Lateinamerika, die auf die freien Märkte gesetzt hätten, in «darbender Armut» darnieder lagen (S. 8).
Nachdem die japanische Wirtschaft die neoklassischen Ökonomen während Jahrzehnten durch ihr enormes Wachstum frappiert habe, sei sie Anfang der 1990er Jahre unerklärlich in eine tiefe Rezession geraten. Die Arbeitslosigkeit stieg in den späten 1990er Jahren auf über 3,8 Millionen offiziell registrierter Erwerbsloser. Über 210 000 Unternehmen wurden insolvent. Das hatte «immense soziale Erschütterungen» zur Folge und hinterliess einen «Berg notleidender Kredite». Jedes Jahr nahmen sich etwa 30 000 Menschen das Leben (S. 10). Das Ausmass der Krise sei weit über das hinausgegangen, was man herkömmlich unter einem zyklischen Abschwung verstehe.
Alle wirtschaftspolitischen Massnahmen, wie Zinssenkung oder Erhöhung der Staatsausgaben, die nach neoklassischer Theorie die Wirtschaft hätten beleben sollen, blieben wirkungslos: Die kurzfristigen Zinssätze fielen von 6 % im Jahr 1991 bis auf 0,001 % Anfang 2004, und die langfristigen, mit zehnjähriger Laufzeit, von über 7 % auf 0,4 %. Die Wirkungslosigkeit der Zinspolitik habe den Einsatz «fiskalpolitischer Stimulationsmassnahmen» nahegelegt, um das Land sozial abzusichern. Die Staatsverschuldung stieg im Jahr 2002 auf eine Rekordmarke in Höhe von 150 % des jährlichen Bruttosozialproduktes. Doch die erwarteten Erfolge blieben aus. Die Krise dauerte mehr als zehn Jahre an.
Die «traditionelle Ökonomie» werde von den Tatsachen in Erklärungsnot gebracht, dass weder ein Jahrzehnt von Zinssenkungen auf ein rekordtiefes Niveau noch ein Jahrzehnt der fiskalischen Expansion der japanischen Wirtschaft auf die Beine verhalfen. «Es mag angehen», schreibt Werner, «wenn Theorie und Wirklichkeit über ein oder zwei Jahre auseinanderklaffen.» Demgegenüber könne mehr als eine Dekade eklatanter Leistungsschwäche trotz mustergültiger Stimulationsmassnahmen nur als ein Zeichen dafür gewertet werden, dass die Denkweise des «Mainstreams» mit Fehlern behaftet sei (S. 11).
Die Rolle der «Bank von Japan»
Richard A. Werner, in dessen Lehrbuch die Untersuchung der japanischen Wirtschaftskrise einen zentralen Platz einnimmt, kommt zum Schluss, dass die Verantwortung für die Krise eindeutig bei der Bank von Japan liegt. Die Bank von Japan habe nicht nur die Öffentlichkeit hinsichtlich der von ihr betriebenen Politik hintergangen, sondern auch die Überwachungsfunktion des Finanzministeriums missachtet (S. 384). Sie habe «fortwährend die Zinsen gesenkt, scheinbar ganz im Einklang mit ihren eifrigen Beteuerungen, alles nur Erdenkliche zu unternehmen, um einen Wirtschaftsaufschwung herbeizuführen», während sie tatsächlich «eine über die Massen restriktive Geldpolitik» praktizierte, womit die Krise künstlich verlängert wurde (S. 423). Sie verfolgte Ziele, «die ihrem eigenen politischen Kredo entsprachen und dazu dienten, Strukturveränderungen in Japan umzusetzen und Tatsachen zu schaffen, welche die Deregulierung, die Liberalisierung und die Privatisierung begünstigten» (S. 414).
Die Grundlage für die Rezession habe die Bank von Japan bereits in den 1980er Jahren gelegt, indem sie den Geschäftsbanken «überzogene Kreditwachstumsquoten aufzwang». In einem Jahrzehnt übertriebener Kreditvergabe sei Japan zur «alles dominierenden Macht an den weltweiten Finanzmärkten» geworden. Japanische Investoren tätigten Immobiliengeschäfte und Firmenübernahmen im In- und Ausland. «Rund um den Globus schienen finanzielle und reale Vermögenswerte aller Art, einschliesslich von Kunstgegenständen und ähnlichen Schätzen, ins Visier japanischer Käufer geraten zu sein.» Die expansive Kreditvergabe der Banken trieb die Preise für Vermögenswerte im Immobilienbereich und an den Börsen in die Höhe, bis die Spekulationsblase 1991 platzte und das Kartenhaus innerhalb eines Vierteljahres zusammenkrachte (S. 180).
Während der Krise seien Tausende von Massnahmen zur Deregulierung durchgesetzt worden, welche die USA bereits in den sechziger Jahren während der Verhandlungen über ein Handelsabkommen gefordert hätten: Verwaltungsreformen wurden eingeleitet, die Liberalisierung der Finanzmärkte verfügt und die Kartelle abgebaut. Doch die Wirtschaftsleistung Japans wurde um so schwächer, je weiter sich die japanische Wirtschaft von der traditionellen Nachkriegsstruktur entfernte und sich dem «Aktionärskapitalismus US-amerikanischer Prägung» annäherte. «Mit der Ausbreitung des Aktionärskapitalismus nach US-amerikanischer Machart», schreibt Werner «stieg die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen. Nicht nur die Selbstmordrate nahm deutlich zu, auch die Gewaltverbrechen.»
Wenn man die sozialen Auswirkungen in das Bild einbeziehe, könne kein Zweifel bestehen, dass der Niedergang der Leistungskraft der japanischen Wirtschaft noch viel grösser und folgenreicher war, als die blossen Zahlen vermuten liessen, welche den Einbruch der Wachstumsrate des BIP dokumentieren (S. 133).
Über das Wesen des Geldes und der Banken
«Bankgeschäfte», schreibt Werner, seien «seit Tausenden von Jahren unverzichtbarer Bestandteil der wirtschaftlichen Aktivitäten der Menschheit» (S. 212). Sie seien älteren Datums als das geprägte Geld. Schon im dritten vorchristlichen Jahrtausend sei das Bankgewerbe in Mesopotamien weit verbreitet gewesen. Bankdienstleistungen waren auch das «Herzstück» der antiken Wirtschaft. «Bankvertreter stiegen zu einflussreichen Senatoren auf – und Senatoren waren im Bankgeschäft aktiv» (S. 211). Zwischen dem dritten und sechsten Jahrhundert nach Christus nahmen in Europa Gold- und Silberschmieden die Funktion der Banken wahr, und auch hier seien Bankdynastien stets eng mit Politik und Wirtschaft verknüpft gewesen. Banken seien der Dreh- und Angelpunkt jeder Volkswirtschaft; alle bargeldlosen Transaktionen werden über Banken abgewickelt. Sie seien aber nicht nur die «Buchhalter» der Volkswirtschaft, sondern versorgen die Wirtschaft auch mit neuem Geld, das sie aus dem Nichts durch Kreditvergabe neu schaffen dürfen, und sie entscheiden über die Zuteilung des Geldes und somit darüber, welche Wirtschaftszweige wachsen und welche nicht. Das verleiht ihnen enorme Gestaltungkraft und Macht. Wie das Beispiel Japans zeigt, sind sie auch in der Lage, Krisen zu erzeugen, sie zu verschärfen und sie zu verlängern.
«Die Banken», schreibt Werner, «beschränkten sich keineswegs nur auf das Einlagen- und Kreditgeschäft. Zu ihren Domänen gehörten auch der Handel, der Bergbau, die Fertigungswirtschaft und die Steuereintreibung (Erwerb des Rechts, die Steuer einzutreiben und Überschusserträge einzubehalten). Die Banken finanzierten die Regierungen und deren Feldzüge» (S. 210). Nicht zuletzt wegen ihrer «Verbindung zum Kriegswesen» seien sie am Verlauf der Weltgeschichte massgeblich beteiligt gewesen (S. 212).
Militärische Konflikte hielten die Welt unvermindert in Atem. Bei allen Unterschieden der auslösenden Umstände gebe es aber auch Gemeinsamkeiten: «Häufig anzutreffende Anlässe für kriegerische Auseinandersetzungen liegen im Bereich ökonomischer Ungleichheit; eine grosse Rolle spielen Rivalitäten um knappe Ressourcen – von Wasser, Öl und Rohstoffen bis hin zu fruchtbarem Land.» An ökonomischen Motiven für kriegerische Auseinandersetzung habe es nie gemangelt (S. 21).
Geld- und Kreditschöpfung aus dem Nichts
Was den Alchemisten im Mittelalter nicht gelungen ist, nämlich aus Blei Gold herzustellen, sei den Banken mit der Fähigkeit gelungen, Geld aus dem Nichts zu schöpfen und Zins- und Zinseszins dafür zu erhalten.
Das Kreditgeschäft mit Zinsen und Zinseszinsen ist ausserordentlich profitabel und im Vergleich zu anderen Industriezweigen, wo neue Güter produziert werden, nur mit geringem Aufwand verbunden. Wenn jemand zum Beispiel ein befristetes Darlehen von 100 000 Euro zu einem Jahreszins von 8 % aufnimmt, wird er nach zehn Jahren 221 964 Euro zurückgezahlt haben; nach 30 Jahren wären es bereits 1 093 573 Euro (S. 216). Kein geringerer als Baron Rothschild soll den Zinseszins als «das achte Weltwunder» bezeichnet haben.
Was Banken und Zentralbanken aber wirklich einzigartig mache, sei ihre Fähigkeit, Geld aus dem Nichts zu schöpfen. Zwar gäben Geschäftsbanken heute keine Banknoten mehr aus, wie vor der Entstehung von Zentralbanken, doch sei die Vergabe von Krediten bis heute ihr wichtigstes Geschäft geblieben.
Bei der Kreditvergabe werde aber nicht Geld, das schon existiert, auf neue Verwendungszwecke umgeleitet, sondern neues Geld erzeugt, welches ohne den Kredit nicht vorhanden wäre. «Banken schöpfen Geld aus dem Nichts.» Der Schuldner erhalte ein «fiktives Einlagenzertifikat» oder einen entsprechenden Eintrag auf seinem Konto, obwohl er in Wahrheit keine oder nur eine viel geringere Einlage geleistet habe (S. 220 f.). Hierzu bediene sich die Bank einer «kreativen Buchführung», indem sie «eine buchhalterische Fiktion» in die Welt setze, nach welcher es so aussieht, als habe der Kreditnehmer entsprechende Mittel hinterlegt (S. 230).
Die Fähigkeit der Kredit- oder Geldschöpfung – beide Begriffe werden synonym verwendet – erkläre, warum Banken in der Geschichte so rasch zu Vermögen und grossem Einfluss gekommen seien. Sie liefere «den Schlüssel dafür, warum es den Banken gegeben war, sich in verschiedenen Wirtschaftszweigen in prominenter Stellung zu etablieren, Firmen und ganze Industrien zu gründen und – nicht selten auch durch Aufkauf – zu beherrschen». Eine Lizenz zum Gelddrucken könne das Leben mitunter erleichtern, meint Werner (S. 231).
Staatliche Geldschöpfung
Im Verlauf der Geschichte haben auch Staaten immer wieder von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, selbst Geld zu schöpfen, um die Staatsausgaben zu finanzieren. Das habe den Vorteil, dass keine Schulden anfallen, welche die Zahlung von Zinsen und Zinseszinsen erzwingen würden. In den meisten Industrienationen, ganz besonders in den USA und in Japan, seien die Verbindlichkeiten wegen des Zinseszinseffekts beträchtlich, so dass Generationen von Steuerzahlern die Schulden abtragen müssten.
Thomas Jefferson (1743–1826), der dritte Präsident der Vereinigten Staaten, war ein Gegner privater Zentralbanken. Unter seiner Regierung erlaubte die amerikanische Verfassung der Regierung ausdrücklich, selbst Geld zu schöpfen. Doch seit der Entstehung der heute noch in privatem Besitz befindlichen Federal Reserve im Jahre 1913 sei man immer mehr von diesem Weg Jeffersons abgekommen. Damit habe man sich eine erhebliche Staatsverschuldung und den dazugehörigen Kapitaldienst aufgeladen. Heute übten in den USA das Banksystem und die Banken der Federal Reserve – alle in Privatbesitz – ein Monopol über die Kreditschöpfung aus.
Einer der wenigen Präsidenten, der dieses monopolistische System herausforderte, war John F. Kennedy. «Mit seiner Präsidialanordnung Nr. 11.110 – eine seiner letzten – verfügte er 1963 die Emission von ‹United States Notes›, staatliche Banknoten, die optisch fast mit den ‹Federal Reserve Notes› identisch waren, aber nichts mit der privaten Institution der Federal Reserve zu tun hatten.» Nach seinem Tod hatte allerdings kein Präsident mehr den Mut, seine Anordnung durchzusetzen (S. 332 f.).
Ein Beispiel aus dem 13. Jahrhundert ist das chinesische Papiergeld. Wie kunstvoll der mongolische Herrscher Kublai Khan (1215–1294) dieses Zahlungsmittel herstellen liess und wie er seine Akzeptanz im ganzen Mongolenreich durchsetzte, zeigen die Aufzeichnungen des venezianischen Händlers Marco Polo (1254–1324), die Werner ausführlich zitiert. Das Papiergeld war nicht mit Gold gedeckt. Im Gegenteil: Die Händler brachten dem Kaiser «Perlen, Edelsteine, Gold, Silber und andere wertvolle Sachen» und tauschten sie gegen die Geldscheine ein, mit denen sie alles kaufen und bezahlen konnten. Und der Kaiser konnte mit der Erweiterung oder Verknappung des Geldflusses die Konjunktur der Wirtschaft nach Belieben steuern (siehe Kasten «Das chinesische Papiergeld»).
Auslandinvestitionen
Vor allem wirtschaftlich schwache und sogenannte Entwicklungsländer erhoffen sich von ausländischen Direktinvestitionen wirtschaftlichen Aufschwung und Entwicklung. Diese, warnt Werner, brächten allerdings häufig auch erhebliche Nachteile mit sich: Zum einen hätten ausländische Investoren ihre eigenen Interessen, die häufig nicht mit denen der betreffenden Entwicklungsländer übereinstimmen. Und zum anderen hätten jene, die sich im Besitz der «Realvermögen» befänden, auch die «Verfügungsgewalt» über die Gewinnverwendung, die Schliessung von Produktionsstätten oder den Rückzug aus dem Ausland. «Warum also», fragt Werner, «sich im Ausland verschulden, Zins- und Tilgungszahlungen leisten, wenn man die Mittel [um inländische Ressourcen zu mobilisieren] im eigenen Land zum Nulltarif erzeugen kann? Schliesslich machen die Auslandbanken auch nichts anderes; sie lassen Geld durch den Kreditschöpfungsprozess ‹aus dem Nichts› entstehen» (S. 280).
Es braucht eine neue Wirtschaftspolitik
Die neoklassische Ökonomie habe ihre Chance gehabt, der Welt zu echten Fortschritten zu verhelfen. Sie habe versagt und bewiesen, dass «freie Märkte» in der realen Welt unmöglich ein soziales Optimum herbeiführen könnten. Daher sei es an der Zeit, eine neue Art der Ökonomie zu begründen.
Die Neoklassik spreche von «Wettbewerb» als einem «Schlüsselmechanismus». Doch in Wirklichkeit habe «der Markt» für den sogenannten «Marktkapitalismus» eine viel geringere Bedeutung als gemeinhin angenommen wird. Wirtschaftliche Lösungen würden «in Wahrheit nicht an Märkten ausgehandelt, sondern von Allokateuren [Investmentbanken und anderen Grossinvestoren] dekretiert» (S. 437).
Der grösste Teil der weltweiten Wirtschaftsaktivitäten werde von wenigen Grossbanken kontrolliert, die in vielfacher Hinsicht mächtiger als die Regierungen seien. Sie kontrollieren die Schöpfung und die Verteilung der Kredite, seien aber keiner direkten demokratischen Kontrolle unterstellt; was die Demokratie in hohem Mass gefährde.
Die Geldpolitik sei die wirksamste Gestaltungskraft bei der Durchsetzung makroökonomischer Ziele. Denn sie beeinflusse nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern vermöge auch gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. «Wegen der ungeheuren Macht und Tragweite der Geldpolitik, die es erlaubt, die volkswirtschaftlichen Ressourcen zu kontrollieren und zu lenken, sollte sie einer Institution anvertraut werden, die fest verankert ist im demokratischen Prozess – so wie etwa das Finanzministerium.» Wie kann es richtig sein, fragt Werner, dass die wachstumsneutrale Finanzpolitik in den Parlamenten debattiert wird, aber nicht die sowohl wachstumsbestimmende als auch die der Umverteilung und Strukturpolitik dienende Geldpolitik (S. 451)?
Die Fiskalpolitik – alle Massnahmen, die die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte betreffen, darunter Steuern, oder auch die Ausgabe von Staatsanleihen – sei «wachstumsneutral». Deshalb solle man von ihr nur mit grösster Zurückhaltung Gebrauch machen. Sie sei ausschliesslich ein Instrument der Umverteilung.
«Um Netto-Wohlfahrtsverluste zu vermeiden, die bei unnötiger Staatsverschuldung und unwirtschaftlichen Zinslasten entstehen, sollte das Prinzip eines ausgeglichenen Haushalts beherzigt werden», fordert Werner (S. 450).
Der erste Schritt bei der Umsetzung eines neuen Paradigmas der Makroökonomie sollte deshalb darin bestehen, die Entscheidungsgewalt über Kreditschöpfung und die gesellschaftliche Zuteilung von Kredit demokratischen Kontrollen zu unterwerfen und eine Wirtschaftspolitik anzustreben, die bessere und sozial ausgewogenere Resultate zeitige als die zurzeit vorherrschenden Ansätze des Mainstream (S. 454). Besonders dringlich sei hierzu die Kontrolle der Zentralbanken.
Doch mahnt Werner zugleich zur Vorsicht: Ein plumpes Intervenieren unverständiger staatlicher Stellen werde kaum von Erfolg gekrönt sein. Der Staat müsse darauf achten, den Individuen maximale Handlungsfreiheit einzuräumen und den Umfang seiner Direkt-interventionen nur auf unverzichtbare Anlässe zu beschränken. Ein Eingreifen sei vor allem dann nötig, wenn die Kreditschöpfung in unproduktive Verwendungszwecke fliesse und spekulative Transaktionen im Immobilienbereich, den Erwerb von Hedgefonds oder Übernahmeaktivitäten finanziere. Um die Bildung von Preisblasen und Inflation zu verhindern, müsse das Geld für produktive und wertschöpfende Zwecke verwendet werden.
Werner präsentiert das japanische Beispiel des Hochwachstums, ruft aber auch zu neuer Forschung auf. Es sei erforderlich, dass die Forschung sich noch viel intensiver mit der Gestaltung zweckmässiger Institutionen, sinnvoller Anreizsysteme und den tatsächlichen Verhaltensweisen der Menschen beschäftige – «ein weites Feld von höchster Bedeutung für die theoretische Begründung und praktische Verwirklichung der Grundsätze einer Rechts- und Wirtschaftsordnung» (S. 451). Vor dem, der sich auf den Weg zu einer neuen Art der Ökonomie begebe, schreibt Werner, breite sich ein gewaltiges Forschungsprogramm aus. Es brauche den Mut, eine echte, praxisnahe und realitätsbezogene Volkswirtschaftslehre durchzudenken, zu debattieren und anzuwenden.
Nachtrag
Seit der Veröffentlichung des Lehrbuchs sind inzwischen dreizehn Jahre vergangen. Ich denke, dass es nichts an Aktualität eingebüsst hat. Werners noch früher erschienenes Buch «Princes of the Yen» (Quantums-publishers.com), das in Japan ein Bestseller war, wird in diesem Jahr auf Deutsch erscheinen.
Heute mehren sich die Stimmen, die sagen, dass die Schere zwischen armen und reichen Ländern und zwischen Armen und Reichen innerhalb der einzelnen Länder immer weiter auseinandergeht. Die Corona-Pandemie scheint diesen Trend weiter zu verstärken.
Es vergeht kein Tag, an dem im Wirtschaftsteil der Zeitungen nicht vor einem möglichen oder bereits bevorstehenden Crash gewarnt wird. Die Preise für Aktien oder Immobilien sind wie vor der japanischen Rezession in unrealistische Höhen geschossen und steigen trotz Krise weiter. Das Geld fliesst in die Finanzindustrie und nicht in die Realwirtschaft. Die Börse ist zum Casino verkommen. Und ein neues Computer-Geldsystem in Form von «Kryptowährungen» ist bereits in Vorbereitung. Grund genug, der Forschung für eine «Neue Wirtschaftspolitik» erste Priorität einzuräumen.
«Wir haben Anlass, Volkswirtschaften in einer Weise zu gestalten, die mehr Raum bietet für kooperatives Verhalten; es obliegt uns, eine sozial verträgliche Form des Kapitalismus zu begründen, der die Wohlfahrt aller im Auge hat, und in dem jeder als wertvoller Mensch angesehen werden wird», schreibt Richard A. Werner (S. 450). •

(Bild zfg)
zf. Richard A. Werner ist ein deutscher Wirtschaftswissenschafter und Universitätsprofessor. Nach Abschlüssen der London School of Economics und der Universität von Oxford (Promotion) lehrte er u. a. an der Sophia Universität, Tokio, der Universität von Southampton, England, der Goethe-Universität, Frankfurt, der Corvinus-Universität Budapest und ist derzeit Professor of Finance der Fudan Universität, Shanghai, und Professor für Bank- und Finanzwissenschaften an der De Montfort Universität in Leicester, England. Er hat zudem Erfahrung in der Finanzbranche gesammelt, u. a. als Chefökonom der britischen Investmentbank Jardine Fleming Securities (Asia) in Tokio, als Senior Consultant der Asiatischen Entwicklungsbank in Manila und als Senior Managing Director von Bear Stearns Asset Management in London. Sein 2001 erstmals auf japanisch erschienenes Buch «Princes of the Yen» gelangte auf Platz 1 der Bestsellerliste. 1995 veröffentlichte er in der japanischen Finanzzeitung Nikkei seinen Vorschlag einer neuen Geldpolitik, um schnell Bankenkrisen zu beenden, den er «quantitative Lockerung» nannte, und welcher bei vielen Zentralbanken bekannt wurde. Richard Werner ist Gründungsmitglied und Vorstand von Local First Community Interest Company, einem gemeinnützigen Unternehmen, das auch in Grossbritannien Lokalbanken nach dem Vorbild deutscher Genossenschaftsbanken und Sparkassen einführt.
Das chinesische Papiergeld
«In Khanbalik befindet sich die Münzstädte des Grosskhans. Wenn man sieht, wie sie eingerichtet ist, könnte man sagen, der Gross-khan habe die Kunst der Alchemie gemeistert. Das werde ich euch hier und jetzt demonstrieren.
Ihr müsst wissen, dass er nach folgendem Verfahren Geld für sich herstellen lässt, aus der Rinde von Bäumen – genauer gesagt von Maulbeerbäumen (deren Blätter den Seidenraupen als Nahrung dienen). Der feine Bast zwischen Rinde und Holz wird abgezogen. Er wird dann verkrümelt, gestossen und gewalzt mit Hilfe von Kleber in Blätter, ähnlich wie Baumwollpapier, die alle schwarz sind. Die fertigen Blätter werden in Rechtecke von verschiedener Grösse geschnitten. […] Alle Geldscheine werden mit dem Siegel des Gross-khans versehen. Die Ausgabeprozedur ist so offiziell und höchstamtlich, als ob sie aus reinem Gold oder Silber hergestellt wurden. Auf jedem Stück Geld unterschreiben speziell ernannte Beamte mit ihrem Namen und setzen ihr eigenes Siegel. Wenn die Prozedur nach allen Vorschriften vollendet ist, taucht der oberste der vom Khan ernannten Beamten das an ihn verliehene Siegel oder die ihm anvertraute Bulle in Zinnober und drückt es auf die obere Seite der Geldnote, so dass die Form des Siegels in Zinnoberrot darauf haften bleibt.
Und dann ist das Geld echt. Und sollte jemand es fälschen, würde er die höchste Strafe erleiden.
Von diesem Geld lässt der Khan eine solche Menge herstellen, dass er damit alle Schätze der Welt kaufen könnte. Mit diesem Geld, das fabriziert wird, wie ich es eben geschildert habe, wird alles bezahlt: in sämtlichen Provinzen, in jedem Königreich, im ganzen kaiserlichen Machtbereich ist es das einzige Zahlungsmittel. Sollte sich jemand weigern, es anzunehmen, droht ihm die Todesstrafe. Doch ich versichere euch, jeder einzelne, alle Völker des Reiches nehmen diese Papiere gerne als Zahlungsmittel an, denn wohin sie auch immer gehen, die Scheine gelten überall; die Leute erstehen damit Waren, Perlen und Gold und Silber. Mit diesen Papierstücken können sie alles kaufen und für alles bezahlen. Und dabei wiegen die Scheine, die soviel wie zehn Byzantiner wert sind, nicht einmal soviel wie einer.
Oft im Jahr kommen die Händler gruppenweise nach Khanbalik und bringen dem Kaiser Perlen, Edelsteine, Gold und Silber und andere wertvolle Sachen wie Gold- und Seidenstoffe. Der Gross-khan ruft zwölf Beamte zu sich. Diese sind für das Amt gewählt worden, die Waren der Kaufleute zu begutachten, einzuschätzen und den entsprechenden Wert in Papiergeld auszuzahlen. Die zwölf Kundigen untersuchen alles nach ihrem Gutdünken, setzen den Preis fest und entrichten ihn in Papierwährung. Die Kaufleute freuen sich über die Scheine, denn damit können sie alles kaufen, was ihnen beliebt und gefällt im grossen Tatarenreich.
Es ist die pure Wahrheit: Mehrere Male im Jahr liefert die Kaufmannschaft Waren im Wert von ungefähr vierhunderttausend Byzantinern; der Kaiser vergütet alles in Papiergeld.
Aber hört weiter: Oftmals im Jahr wird in den Städten der Befehl bekannt gemacht, jeder Besitzer von Edelsteinen und Perlen, von Gold und Silber müsse alles zur kaiserlichen Münzstätte bringen. Jedermann gehorcht, und eine Unmenge von kostbaren Gegenständen sammelt sich an und wird in papierene Scheine umgesetzt. Auf diese Weise häufen sich die Metalle und Steine aus dem ganzen Reich in den Schatzkammern des Grosskhans. Und all die Armeen des Khans werden mit diesem Papiergeld bezahlt.
Ich habe euch nun berichtet, wie es kommt, dass der Grosskhan mehr Schätze besitzt als alle anderen in der Welt. Ich kann weitergehen und bestätigen, dass alle Mächtigen der Welt zusammen nicht soviel besitzen wie der Khan allein.»
Marco Polo, zitiert nach Werner S. 213f.