Zwischen linksgrüner Hegemonie und radikaler Pegida-Bewegung
Zwischen linksgrüner Hegemonie und radikaler Pegida-Bewegung
Buchbesprechung
Ulrich Greiner: Eine Rückbesinnung auf die Fundamente unserer Kultur
von Winfried Pogorzelski*
Mit seinem Buch Heimatlos – Bekenntnisse eines Konservativen hat Ulrich Greiner, ehemaliger Leiter des Feuilletons der Wochenzeitung Die Zeit, eine geistreiche Schrift vorgelegt, in der er seine eigene weltanschauliche und intellektuelle Biographie sorgfältig rekonstruiert und klug kommentiert. Mit dem Titel «Heimatlos» rekurriert er auf ein Buch gleichen Titels von Johanna Spyri, Schweizer Jugendschriftstellerin und Schöpferin der Romanfigur Heidi, das den Autor als Kind zu Tränen gerührt hatte.
Greiners Buch ruft den älteren Semestern unter uns vieles in Erinnerung, was sich in den letzten Jahrzehnten und Jahren an wichtigen Entwicklungen vollzogen hat: von der deutschen Nachkriegszeit über die Studentenbewegung und die deutsche Wiedervereinigung bis zur fortschreitenden Globalisierung und zur Flüchtlingswelle. Die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Islamismus wird ebenso thematisiert wie der Trend zu Multikulturalismus und Vegetarismus. Vor allem aber liegt ihm daran, Bewahrenswertes ins Blickfeld zu rücken, das auf keinen Fall einem wie immer daherkommenden Zeitgeist geopfert werden sollte.
Die Geisteshaltung des Konservativismus

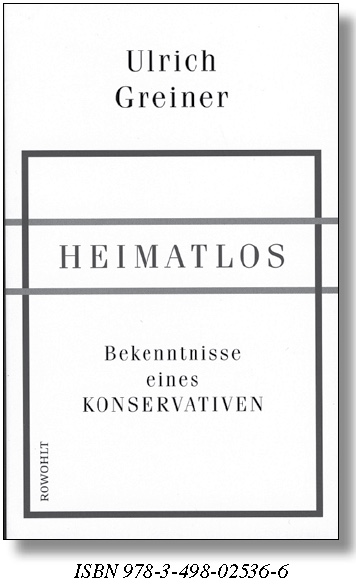
Dem Autor geht es, wie er betont, nicht um die Entwicklung einer Theorie oder eines Programms des Konservativismus, der im Gegensatz von linken und reaktionären Ideologien bzw. politischen Bewegungen keine «Bevormundung aus dem Geist der Utopie» (S. 41) kennt. Sein Anliegen ist es, das deutliche Unbehagen auf den Punkt zu bringen, das inzwischen immer mehr Menschen ergreift, die etwas nicht automatisch gut finden, nur weil es neu ist. In der Einleitung spricht er von der Sozialdemokratisierung der CDU durch Angela Merkel, von der Euro-Rettung, dem Freihandel und von Angela Merkels Umgang mit der Flüchtlingswelle, die unisono von den Medien als alternativlos dargestellt worden seien, oder auch von der Verurteilung des Fleischkonsums und der Propagierung des Vegetarismus, die zur Political correctness gehören. In neun Kapiteln legt Greiner seine Beobachtungen und Überlegungen dar, untermauert durch Rückgriffe auf historische Ereignisse und Entwicklungen, auf Biographien und Schriften bedeutender Autoren. Stichworte aus den Kapitelüberschriften sind unter anderen: Die linksgrüne kulturelle Hegemonie, Das Eigene und das Fremde, Islamkritik und Multikulturalismus, Die Ideologie der Machbarkeit – Sterbehilfe und Reproduktionsmedizin, Der erprobte Nationalstaat, Gleichheitsversprechen und Grenzen des Sozialstaats.
Das Eigene und das Fremde
Eine typische Grundhaltung, so Greiner, ist der verbreitete Selbsthass vieler Angehöriger unserer Kultur, der darin zum Ausdruck komme, dass das Eigene kritisiert, während das Fremde unkritisch erst einmal als besser, exotischer, authentischer beurteilt werde, nur weil es einer anderen, uns zunächst fremden Kultur entstammt. Bei dieser Einstellung werde «alles, was nach christlicher Tradition aussieht, unter dem Deckmantel multikultureller Fairness verleugnet» (S. 40). Nahezu die gesamte Geschichte unseres Herkommens sei nun aber mal von dem geprägt, was man «christliches Abendland» (ebd.) nennt. Folglich geht es dem Autor darum, die Unterschiede zwischen dem Eigenen und dem Fremden nicht zu verwischen, was Multikulturalismus und Willkommenskultur fleissig betrieben: Zu unserer Tradition gehöre die christlich geprägte Leitkultur – zuletzt für ihn gültig vom deutschen Innenminister Thomas de Maizière definiert – mit ihren ungeschriebenen Regeln des Zusammenlebens, wozu wesentlich gehöre, dass man friedlich zusammenlebt und das Recht Vorrang vor religiösen Regeln hat. So sei uns zum Beispiel die islamische Kultur fremd, und – so darf man wohl ergänzen – wird es auch immer bleiben. Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit wurden und werden dort ganz anders gehandhabt als bei uns. Der Gegensatz zwischen Fremdem und Eigenem muss deutlich bleiben, betont Greiner mit Verweis auf Demonstrationen von Türken für die Einführung der Todesstrafe in der Türkei.
Greiner unterstreicht einige Unterschiede zwischen Christentum und vorsäkularen Religionen wie dem Islam, selbstverständlich ohne das Christentum als allein seligmachende Religion in den Himmel zu heben. So sei der Grundsatz «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst» christlich, es gebe im Christentum keine Aufforderung, Andersgläubige zu ermorden oder Selbstmordattentate zu verüben. Der Opfertod Jesu sei revolutionär, weil er das Prinzip der Vergeltung aufhebe: Statt andere zu opfern, opfert sich der Gottessohn selbst, um dem Kreislauf der Gewalt ein Ende zu machen. Das heisse freilich nicht, dass Christen per se die besseren Menschen seien. Auch im Verlauf der Geschichte des Christentums habe es bekanntlich Schattenseiten, verheerende Entgleisungen gegeben. Diesen Teil seiner Ausführungen schliesst der Autor mit der Bemerkung: «Die historische Erfahrung zeigt: Wer sich des Eigenen sicher ist, muss es nicht näher bestimmen, er kann selbstbewusst auf das Nicht-Eigene und Fremde zugehen. Doch die Zeiten sind nicht danach. Das Eigene ist fraglich geworden, und was einst normal war, ist es längst nicht mehr.» (S. 75)
Ideologie der Machbarkeit versus Selbstbeschränkung
Greiner spricht von der sich immer mehr verbreitenden «Ideologie der Machbarkeit» (S. 77), vom Bestreben des modernen Menschen, «Gott sein zu wollen» (ebd.). Im Gegensatz hierzu ist sein Konservativismus von Behutsamkeit und Selbstbeschränkung gekennzeichnet. Er zeigt dies am Beispiel von Sterbehilfe und Reproduktionsmedizin. Beidem steht er äusserst skeptisch gegenüber, geht es doch immer um ein – nur sogenanntes – Recht auf Selbstbestimmung, das mit immer grösserer Selbstverständlichkeit eingefordert werde. Zunächst hält der Autor fest, dass der sogenannte Freitod namhafter Zeitgenossen immer wieder öffentlichen Beifall erhalten habe, man halte sie für tapfer oder gar mutig. Greiner hingegen fragt: «Verwirklicht der Mensch im Suizid seine Freiheit – oder verwirkt er sie nicht für immer?» (S. 79) Er zitiert den Schriftsteller Reinhold Schneider, der der Auffassung ist, der Selbstmord sei nicht auf das Ich beschränkt. Der Selbstmörder trage «etwas Entsetzliches in die Welt, etwas, das nicht in ihr sein soll und das ihre Ordnung bedroht. […] Seine Haltung, sein Denken haben etwas Zerrüttendes. Niemand wird schuldig an sich allein, weder in diesem noch in irgendeinem anderen Sinn. Denn das Gesetz der Ordnung, der Erhaltung, Verwaltung ist allen gegeben: Darum frevelt ein jeder, der dieses Gesetz verletzt, an allem.» (S. 79f.)
Im weiteren Verlauf des Kapitels kommt Greiner auf den Schutz von Ehe und Familie zu sprechen, den die meisten Staaten der Welt gewähren. Ihn überkommt ein ungutes Gefühl bei dem Gedanken, dass auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten und Kinder adoptieren können sollen. Dieses Gefühl sagt ihm, «dass es nicht gut wäre, eine Institution, die seit Menschengedenken für die rechtsförmige Verbindung von Mann und Frau und für die Legitimierung ihrer Nachkommen gedacht war und immer noch ist, dadurch zu öffnen, dass man eine ‹Ehe für alle› ermöglicht» (S. 83). Im folgenden führt er immer öfter und selbstverständlicher vorgebrachte Einwände gegen das Monopol der klassischen verschiedengeschlechtlichen Ehe an. Für viele ist «die Vorstellung, dass Zuneigung, Sexualität und Zeugung miteinander notwendig zusammenhingen», ebenso obsolet wie der «Gedanke, nur auf natürlichem Weg zur Welt gebrachte Nachkommen seien akzeptabel.» (ebd.) Die Nutzniesser der Reproduktionsmedizin würden Fortschritte auf diesem Gebiet nur begrüssen. Der Konservative hingegen, so Greiner weiter, empfinde angesichts dieser Entwicklung ein beträchtliches Unbehagen. In Deutschland entstünden auf künstlichem Weg pro Jahr bereits etwa zehntausend Kinder, was die Aufhebung bisheriger Abstammung bedeutet: «Die genealogische Ordnung, die eine kulturelle Leistung erster Ordnung darstellt, scheint an ihr Ende gekommen.» (S. 84) Eine sich abzeichnende Folge dieser Entwicklung ist die Eugenik, der mit der Inanspruchnahme von Samenbanken Tür und Tor geöffnet werde. Es bestehe die Gefahr eines regelrechten Optimierungswahns – gefördert durch profitorientierte Reproduktionszentren – derjenigen, die sich diese zweifelhafte Form des medizinischen Fortschritts leisten können. Greiner zieht in diesem Kapitel Bilanz, wenn er analysiert: «Die ‹Selbstverwirklichung› ist das neue Credo. Wenn man sie genauer betrachtet, so handelt es sich eigentlich nur um eine ‹Ichverwirklichung›, also nicht um die Entfaltung einer sozialen, dialogischen Persönlichkeit, sondern um die Durchsetzung eines Egos. Es folgt die Optimierung des Humankapitals, das seine Grenzen nur noch im jeweils Machbaren findet. […] Bei den ersten und den letzten Dingen jedoch, beim Gebären und beim Sterben, gibt es Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Sie definieren sich durch die Geschichte der Menschheit, die, wo sie erspriesslich war, immer ein Produkt aus Natur und Kultur gewesen ist. Sie verdankte sich einer weisen, aus Erfahrung gewonnenen Selbstbeschränkung. Wann immer die Menschen versucht haben, Gott zu spielen, ist es ihnen schlecht bekommen.» (S. 97)
Vereinigte Staaten von Europa oder starker Nationalstaat?
Beim Thema Konservativismus bleibt Greiner auch, wenn es um den Nationalstaat geht: Ein solider Staat, und sei es auch eine Monarchie, war immer das Ziel des Konservativen. Heute befürwortet er als Errungenschaft der Moderne und als Schutz vor jeglicher Tyrannei einen starken Nationalstaat. Der ist aber auf Grund der europäischen Einigung in der EU zunehmend gefährdet bzw. existiert nicht mehr: Die Milliarden-Transfers in andere EU-Länder überschritten in Deutschland deutlich die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin, dazu verlor sie 2015 die Kontrolle über die Flüchtlingswelle. Gremien, deren Mitglieder nicht mehr von den Bürgern gewählt werden, bestimmen zunehmend den Alltag der Bürger. Die nationalen Verfassungen der EU-Mitgliedsländer können ihren Anspruch, dass alle ausgeübte Herrschaft ihre Legitimation vom Volk erhält, nicht mehr einlösen. Die Herrschaftsgewalt geht nicht vom Volk – Demokratie! –, sondern von der Gemeinschaft der Staaten, von Brüssel aus, das viele Entscheidungen trifft, die unser Leben unmittelbar berühren.
Eine Alternative wäre ein wirklicher europäischer Verfassungsstaat, dessen Bürger europäische Staatsbürger und nicht Bürger von Nationalstaaten wären. Die Entwicklung geht allerdings in die entgegengesetzte Richtung: Die EU ist immer mehr geprägt von Heterogenität, die zentrifugalen Kräfte nehmen zu, die Beteiligung an den Wahlen zum EU-Parlament geht zurück, der Euro eignet sich mitnichten zum Bindemittel einer vertieften Einigung … Eine Reduktion des Brüsseler Apparates, eine Rückkehr zur Kooperation eigenverantwortlicher Staaten wiesen deshalb in die richtige Richtung.
Und dann zitiert Greiner überraschend den französischen Politiker und Historiker Alexis de Tocqueville (1805–1859), Begründer der vergleichenden Politikwissenschaft, der zur Einsicht kam, dass der Gleichheitsgedanke zu einem zentralen Staat tendiert und dass es dazu kommen kann, dass dieser Zentralismus zu einer neuen Despotie führt. Der Souverän, das heisst der Staat, nehme alle in seine Hände, er «breitet seine Arme über die Gesellschaft als Ganzes aus; er bedeckt ihre Oberfläche mit einem Netz verwickelter, äusserst genauer und einheitlicher kleiner Vorschriften, die die ursprünglichsten Geister und kräftigsten Seelen nicht zu durchbrechen vermögen, um sich über die Menge hinauszuschwingen; er bricht ihren Willen nicht, aber er weicht ihn auf und beugt und lenkt ihn, er zwingt selten zu einem Tun, aber er wendet sich fortwährend dagegen, dass man etwas tue; er zerstört nicht, er hindert, dass etwas entstehe.» (S. 118) Greiner gibt unumwunden zu: «Man wird nicht behaupten wollen, die Brüsseler Behörden glichen diesem von Tocqueville skizzierten Souverän, doch wenn man liest, die Kommission beschäftige 35 000 Beamte und das gesamte Gesetzeswerk umfasse mehr als 50 000 Seiten […], dann sind die Unterschiede nicht allzu gross.» (S. 118f.) Tocqueville, von Hause aus Aristokrat, habe den Siegeszug der demokratischen Gesellschaft und ihre Schwierigkeiten vorausgesehen, in «einer Mischung aus Faszination und Befremden. Er war konservativ und zugleich liberal. Ein Mann wie er wäre heute dringend nötig.» (S. 120)
Die Grenzen des Sozialstaates
Auch mit den Grenzen des Sozialstaates setzt sich Greiner auseinander. Der Anspruch auf Gleichheit unter den Menschen werde nie erfüllt werden. Die Ungleichheit gehöre zur menschlichen Existenz. Gleichwohl findet er die «Abgründe zwischen Arm und Reich gespenstisch, die Gehälter ganz oben schwindelerregend und die Zunahme von Unwissenheit und Verwahrlosung ganz unten bedrückend» (S. 123). Selbstredend sei es ein absoluter Skandal, dass der ehemalige Vorstandsvorsitzende des VW-Konzerns, Martin Winterkorn, als Altersversorgung 3100 Euro täglich (!) erhält, während ein Arbeitnehmer mit Höchstrente mit 60 Euro pro Tag auskommen muss. Eine Verstaatlichung der Tugend könne aber nicht gelingen. Hegel sprach davon, dass es gegen das Gefühl der Ärmeren von «ihrer Selbständigkeit und Ehre» (S. 125) wäre, wenn die reichere Klasse für sie aufkommen würde. Der Empfänger staatlicher Fürsorge sei zwar von unmittelbarer Not befreit, aber auch bedroht in seiner Selbstachtung wie der Steuerzahler, der Angehörige der staatstragenden Mittelschicht auch: Wilhelm von Humboldt sei bereits zu der Einsicht gelangt, dass die Neigung des Bürgers zu nachbarschaftlicher Anteilnahme und Zuwendung sinke, je mehr er dazu gezwungen werde, zum anonymen Steuerzahler zu werden (Vgl. S. 127).
Sexuelle Orientierungen und die Suche nach einer besonderen Identität
Was den Autor ebenfalls stört, ist die unablässige, auf die Spitze getriebene Suche bzw. Ausgestaltung einer ganz besonderen Identität des einzelnen. Er orientiert sich hier am kanadischen Philosophen Charles Taylor. Mit Immanuel Kant lege er dar, dass das Achtungswürdige der Menschen darin liege, «dass sie zu vernünftigem Handeln fähig sind, dazu, ihr Leben von Grundsätzen leiten zu lassen […] Was hier als wertvoll hervorgehoben wird, ist ein universelles menschliches Potential, eine Fähigkeit, die allen Menschen gemeinsam ist.» (S. 130) Dieses Potential und nicht das, was der einzelne aus ihm macht oder gemacht hat, sichert jedermann Achtung. Demgegenüber, so Taylor weiter, werde heutzutage die «individualisierte Identität» immer wichtiger, so zum Beispiel die Tatsache, dass ich «dunkelhäutig, weiblich oder homosexuell» bin. (S. 131) Er ortet die Entstehung dieses Gedankens bei Rousseau und Herder: Es gehe nicht mehr darum, das «Allgemeinmenschliche in sich auszubilden, sondern das je Eigene. […] Mir treu zu sein bedeutet: meiner Originalität treu zu sein, und sie kann nur ich allein artikulieren und entdecken. Indem ich sie artikuliere, definiere ich mich.» (ebd.) Nach Greiner widerspricht diese Art von «Identitätspolitik» (ebd.) dem Gleichheitsgedanken, ja sie löst ihn auf. Denn es gehe nun nur noch um die Anerkennung der Differenz. Und diese Anerkennung sei noch immer bedroht, weil sie aus der Geschichte herrühre, etwa dadurch, dass ich als Schwarzer oder als Frau von der Geschichte des Kolonialismus oder des Patriarchats bis heute derart beschädigt bin, dass ich einen Anspruch auf Wiedergutmachung habe.» (S. 132) Von hier aus ist der Schritt zur Gender-Problematik nicht weit: Denn die gesellschaftlich relevante Debatte dreht sich nun immer weniger ums Gesamtwohl als um die Findung der je eigenen Identität. Die Kinder sollen in der Schule nicht allein den Respekt vor abweichenden sexuellen Orientierungen lernen, «sondern auch frühzeitig die Chance erhalten, aus dem reichhaltigen Katalog der geschlechtlichen Optionen das für sie Passende auszuwählen» (S. 133) – in einem Wikipedia-Beitrag kommt man inzwischen auf sage und schreibe 23 verschiedene Geschlechter (!) –, so zumindest laut Lehrplänen in Bundesländern, in denen die Grünen mitregieren. Damit aber geht es vor allem um die Formulierung und Durchsetzung bzw. Befriedigung von potentiell unendlichen Partikularinteressen in einer reinen Anspruchsgesellschaft, die «keine Vision von sich selber hat» (S. 141).
Dem Konservativismus eine Stimme
Die Leitmedien «von den tonangebenden Zeitungen bis hin zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten pflegten einen «Anpassungsmoralismus» […], der gegensätzlichen Meinungen keinen Resonanzboden bietet» (vgl. hinterer Klappentext). Das gelte für die politischen Parteien erst recht. Viele aktuelle Entwicklungen charakterisiert Ulrich Greiner präzise, entkleidet sie ihrer Faszination, die sie auf viele ausüben, und macht damit Mut, sich ihnen entgegenzustellen, fordert auf, sich auf die Grundwerte unserer Kultur zu besinnen. In seinem Schlusswort wird er sich bewusst, dass die in Frage gestellten gesellschaftlichen Haltungen und Mentalitäten weder Politiker und schon gar nicht er selbst einfach so ändern können. Er habe sich vor allem Klarheit bezüglich seines Konservativismus verschaffen wollen. Wenn er viele Leser überzeugen könne, so wäre er nicht mehr heimatlos. Sich damit als konservativer, eigentlicher sozialdemokratisch gesinnter Intellektueller zu outen, scheint ihm nichts auszumachen. •
* Pogorzelski, Winfried, Dr. phil., Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte, Aargau
Greiner, Ulrich. Heimatlos. Bekenntnisse eines Konservativen. Reinbek 2017, ISBN 978498025366