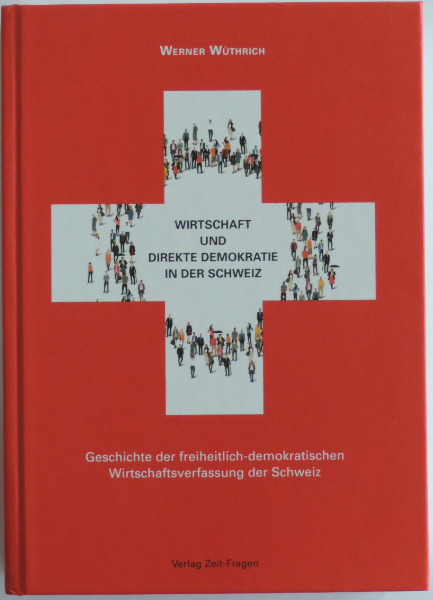«Das Vertrauen ist die härteste Währung im Bankgeschäft»
Gedanken zur heutigen Geld- und Finanzordnung
von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich
Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Glarner Regionalbank versammelten sich vor ein paar Wochen zur Generalversammlung. Peter Zentner, Verwaltungsratspräsident, stellte ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr 2022 vor. Dies sei trotz des schwierigen Negativ-Zins-Umfelds, trotz Corona, Inflation und Ukraine-Krieg möglich gewesen, weil die lokal verwurzelte GRB «nur mache, was sie verstehe». Geschäftsleiter Roman Elmer richtete seinen Blick in die Zukunft mit einer unveränderten Ausgangslage. Die GRB werde «erfrischend-sympathisch-bodenständig» bleiben. Das Vertrauen sei die «härteste Währung im Bankgeschäft». Das hätten auch die grossen Banken lernen müssen.
Die Bank ist mit 1588 Genossenschaftern weder «too big to fail» noch «too small to survive». Sie ist 1928 gegründet worden und hat viel erlebt – Krisen, Kriege, Hochkonjunktur und in neuerer Zeit immer wieder neue Finanzkrisen – so die heutige Vertrauenskrise. Es sei wirklich eine grossartige Leistung der motivierten Mitarbeiter und der Genossenschafter, die der Bank ein stabiles Rückgrat geben, fügte Regierungsrätin Marianne Lienhard an. Der langjährige Erfolg bestätigt den Grundgedanken der zahlreichen in der Schweiz verankerten Genossenschaftsbanken. (Fridolin vom 6. April 2023)
Brüchige Weltwährungsordnung
Ein ganz anderes Bild zeigt ein Blick in die Welt: Heute mangelt es an Vertrauen in die Weltwährungsordnung, wie die Vorgänge um zwei amerikanische Banken und die Credit Suisse zeigen. Auch andere Banken in verschiedenen Ländern stehen unter «Verdacht». Die Behörden «beruhigen», sprechen Garantien aus, versuchen einen «bank-run» zu verhindern, intervenieren massiv wie bei der CS oder bei den beiden amerikanischen Banken. Wirklich beruhigt hat sich die Situation nicht. Der Geldabfluss der First Republic Bank in Kalifornien geht auch nach der «Rettung» weiter («Neue Zürcher Zeitung» vom 26. April 2023).
Vor ungefähr fünfzig Jahren ist die Währungs- und Finanzordnung von Bretton Woods mit ihrer Goldbindung und mit ihren fixen Wechselkursen zusammengebrochen. Neu bilden sich die flexiblen Wechselkurse am Markt. Die Goldbindung wurde verboten, so dass die Notenbanken und zum Teil auch die Geschäftsbanken Geld aus dem Nichts schaffen konnten, wie es so schön im Titel des Buches von Mathias Binswanger «Geld aus dem Nichts» heisst.1 Das Geld hat seit damals im Unterschied zu früher keinen eigenen inneren Wert mehr. Es kann beliebig «gedruckt» oder heute elektronisch in die Welt gesetzt werden. Es wird als «fiat money» bezeichnet.
Funktioniert das? hat man sich damals gefragt. Kann eine «Papiergeldwährung», die an nichts mehr gebunden ist, Vertrauen schaffen? Die Glarner Regionalbank hat mit ihrem Geschäftsmodell eine positive Antwort gegeben. Aber sonst? Finanzfachleute beurteilen die heutige Situation weiterhin als brüchig. Ein Rückblick:
Zur Geschichte der heutigen Geld- und Finanzordnung
Die Völker von heute haben in den letzten zwei-, dreihundert Jahren verschiedene Geld- und Finanzsysteme erlebt. In den Jahrzehnten bis zum Ersten Weltkrieg galt der klassische Goldstandard. Das Geld hatte im Gold einen eignen inneren Wert – unabhängig von der Politik. Edelmetalle wie Gold und auch Silber oder Kupfer haben sich seit zwei-, dreitausend Jahren in verschiedenen Kulturen als Geld bewährt. Die Metalle waren knapp, konnten nicht beliebig produziert werden, weil ihre Gewinnung mühselig war und noch ist. Die Münzen waren oft kunstvoll gestaltet. Die bekanntesten Silber- oder auch Goldmünzen im Altertum waren die Drachmen mit der Eule, dem Stadtwappen von Athen. Sie wurden vor 2500 Jahren geprägt und waren im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Sehr beliebt und ebenfalls kunstvoll gestaltet war in neuerer Zeit das Goldvreneli, das die eidgenössische Münzanstalt in der Zeit vor und auch noch nach dem Ersten Weltkrieg herstellte. Heute ist das Goldvreneli ein beliebtes Sammlerstück.
Erst in der beginnenden Neuzeit kam die Idee des Papiergeldes auf, als der Buchdruck erfunden wurde. Von Anfang an stellte sich die Frage des Vertrauens. Wir finden in der Literatur in Faust II von Goethe ein schönes Beispiel: Den Kaiser plagen Geldsorgen, und er lässt sich von Mephistopheles beraten: «Es fehlt an Geld, nun gut, so schafft es denn», sagt der Kaiser zu Mephisto, der auch schon eine Idee hat: Papiergeld. In Goethes Faust scheint die zauberhafte Zettelwirtschaft zunächst alle Finanzprobleme zu lösen. Der Staat kann sich seiner Schulden entledigen, der private Konsum steigt, und es gibt einen Wirtschaftsaufschwung. Im weiteren Verlauf artet das Treiben jedoch in Inflation aus, und das Geldwesen wird infolge der Geldentwertung zerstört. (Goethe war Finanzminister beim Herzog von Weimar. Unter ihm gab es kein Papiergeld.)
Diese Geschichte in Goethes Faust hatte einen realen Hintergrund. Als der Sonnenkönig Louis XIV. in Frankreich starb, hinterliess er seinem Nachfolger nicht nur prachtvolle Bauten wie Versailles, sondern auch einen riesigen Schuldenberg. Er liess sich vom Schotten John Law beraten. Dieser zeigte ihm den Weg, seine Schulden loszuwerden – mit Papiergeld. Das neuartige Experiment dauerte wenige Jahre, bis es zusammenbrach. Danach wollten die Franzosen nichts mehr wissen von Papiergeld – abgesehen von einem kurzen Experiment mit den Assignaten in der Französischen Revolution (das ebenfalls scheiterte). Napoleon kehrte zur Goldwährung zurück.
Zum schweizerischen Geldwesen
Der Bund erhielt mit der Bundesverfassung von 1848 das Münzregal. Die eidgenössische Münzanstalt prägte den Schweizerfranken aus Silber – mit dem gleichen Silbergehalt (4,5 Gramm) wie der französische Franc. In den folgenden Jahrzehnten prägte der Bund den Fünfliber ebenfalls aus Silber sowie 56 Millionen Goldvreneli mit einem Nennwert von 20 Franken (das heute für etwa 400 Franken gekauft werden kann). Etwas später kamen auch Goldmünzen mit dem Nennwert von 10 Franken und 100 Franken dazu. Es war die Zeit des klassischen Goldstandards. 51 Geschäftsbanken gaben individuell gestaltete, mit Gold gedeckte eigene Banknoten für 5, 10, 20 oder 100 Franken heraus. Sie erleichterten den Zahlungsverkehr, waren aber keine gesetzliches Zahlungsmittel und konnten jederzeit in Silber- oder Goldmünzen getauscht werden. Dieses System funktionierte ohne Notenbank. (Die Schweizerische Nationalbank wurde erst 1906 gegründet. Sie erhielt das Banknotenmonopol und vereinheitlichte das System.)
Als die Thurgauer Kantonalbank eigene mit Gold gedeckte Banknoten herausgab, unterzeichnete der Bankpräsident die ersten Banknoten eigenhändig. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine relativ friedliche Zeit mit wenigen Kriegen. Der klassische Goldstandard funktionierte recht gut. Es war die Zeit der industriellen Revolution. Strassen, Eisenbahnen, kühne Eisenbahnprojekte wie der Gotthardtunnel wurden gebaut, zahlreiche Unternehmen gegründet … Es war eine höchst dynamische Wirtschaftsentwicklung, die in der Schweiz den Boden für den heutigen Wohlstand bereitete. Da die meisten europäischen Länder den Silber- und Goldgehalt ihrer Münzen untereinander absprachen, konnte man – ohne zu wechseln – mit dem Schweizerfranken in Rom, Athen oder in Paris bezahlen, weil der Silber- oder Goldgehalt der Lira, der Drachme oder des französischen Franc gleich waren wie der des Schweizerfrankens. Diese Vereinbarung war einfach und funktionierte, ohne dass die einzelnen Länder ihre Währung aufgeben mussten. In der Schweiz gab es in dieser Zeit keine Bankzusammenbrüche. Es war eine relativ glückliche, goldene Zeit fast ohne Krieg. Sie bekam zu Recht den Namen Belle Epoque.
Hyperinflation in Deutschland
Der Erste Weltkrieg war auch für das Geldwesen eine Katastrophe. Der Goldstandard wurde aufgehoben und die Notenpresse zur Finanzierung des mörderischen Krieges herangezogen. In Deutschland waren nach dem verlorenen Krieg die Kassen leer, zudem drückte die Last der Reparationen. Die Notenpresse lief Tag und Nacht, solange, bis sich der Wert der Reichsmark und die Schulden in nichts auflösten. Die Sparer verloren alles. Die Bürger sollten diese Erfahrung nicht so schnell vergessen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die Deutschen nochmals etwas Ähnliches. In der Währungsreform der Bundesrepublik Deutschland von 1948 erhielten die Bürger für 10 Reichsmark noch 1 D-Mark – immerhin. Aber auch dies war ein schmerzvolles Ereignis. International orchestrierten die USA eine neue Geldordnung.
Bretton Woods
Die späteren Siegermächte beschlossen am 11. Juli 1944 das Bretton-Woods-Abkommen. 44 Länder schlossen sich an – auch die Schweiz. Es basierte auf festen Wechselkursen, die in Gold und US-Dollar definiert waren: 1 US-Dollar entsprach 0,889 g Gold; 1 Schweizerfranken war 0,203 g Gold wert, somit kostete 1 Dollar 4,37 Schweizerfranken. Die festen Wechselkurse konnten mit einem komplizierten Verfahren geändert werden, falls sich ein Land stark verschuldete. Den US-Dollar setzten die USA als globale Leit- und Reservewährung ein. Sie versprachen, jeden Dollar jederzeit in Gold umzutauschen – allerdings nur gegenüber den beteiligten Notenbanken und nicht mehr – wie im klassischen Goldstandard – gegenüber den Bürgern. Der US-Dollar sei so gut wie Gold, sagte die US-Regierung, und er eigne sich gut als Handels- und Reservewährung. – Das Vertrauen in die Ordnung von Bretton Woods basierte auf einem Versprechen.
Schweizer Stimmbürger halten an der Golddeckung fest
Nun geschah etwas, was in der Geschichte des Geldes einmalig war. In der Schweiz konnte der Stimmbürger über einen neuen Verfassungsartikel abstimmen, dem das Versprechen von Bretton Woods zugrunde lag. «Der Bund hat das ausschliessliche Recht, Banknoten herauszugeben, und er bestimmt Art und Umfang der Deckung», hiess es in Artikel 39 der Bundesverfassung. Der Bund hätte also das Gold durch den Dollar ersetzen können, wie es die US-Regierung empfahl – ganz oder teilweise. Die Schweizer Behörden, der Bundesrat, das Parlament und die Leitung der Schweizerischen Nationalbank empfahlen dem Stimmvolk ein Ja in die Urne zu legen. Es kam anders.
Die Stimmbürger, die zwar nur als Zuschauer die beiden Währungsreformen in Deutschland miterlebt hatten, stimmten am 2. Mai 1949 mit über 61,5 Prozent Nein. Fast alle Kantone stimmten mit Nein. Zwei Jahre später, am 15. April 1951, stimmten sie einem Verfassungsartikel zu, der den zentralen Satz enthielt: «Die ausgegebenen Banknoten müssen durch Gold und kurzfristige Wertpapiere gedeckt sein.» Das war rechtlich möglich – aber nicht im Sinne der Amerikaner, die ihre eigene Währung als so gut wie Gold ansahen. Das Nationalbankgesetz schrieb zwar schon vorher vor, dass die Banknoten (die damals bereits nicht mehr einlösbar waren) zu mindestens 40 Prozent mit Gold gedeckt sein müssten. Nun wurde jedoch die Golddeckung in der Verfassung verankert, das heisst, sie konnte ohne Zustimmung des Volkes und der Mehrheit der Kantone nicht abgeschafft werden. Mehr als einundsiebzig Prozent der Stimmenden und alle Kantone stimmten zu.
Wie wurden die
beiden Volksabstimmungen umgesetzt
Die Schweiz erzielte damals – wie auch heute – meist Überschüsse in der Ertragsbilanz, das heisst, sie exportierte meist mehr als sie importierte und erzielte so einen Überschuss. Die SNB setzte nun eine Obergrenze für ihre Dollars. Sobald diese erreicht war, wurde der Mehrbetrag bei den Amerikanern in Gold umgewandelt. Die SNB «drehte» die Dollars in Gold, wie es im Bankjargon damals hiess. Die SNB beschreibt diesen Vorgang in ihrer Jubiläumsschrift von 1981 wie folgt:
«Die Nationalbank konnte bis 1971 einen Überschuss an Dollars beim amerikanischen Schatzamt zum Preis von 35 Dollar pro Unze in Gold umwandeln, wobei die Amerikaner solche Umwandlungen immer weniger gern vornahmen. Ergaben hingegen die Transaktionen am Devisenmarkt einen Nettoabgang von Dollars, so verkaufte die Nationalbank den amerikanischen Währungsbehörden Gold gegen Dollars, um ihren Devisenbestand wieder aufzufüllen.» (Schweizerische Nationalbank 1981, S. 237f.)
Da die Schweizer Volkswirtschaft in der Hochkonjunktur ständig Überschüsse erzielte, stiegen die Goldreserven auf diese Art von ungefähr 800 Tonnen nach dem Krieg bis auf über 2600 Tonnen im Jahr 1971. Diese 2600 Tonnen Gold (verbucht zu 4700 Franken das Kilo) sollten 40 Jahre später zum Politikum werden. In den sechziger Jahren misstrauten auch andere Länder dem Dollar, den die Amerikaner mehr und mehr druckten, um ihren Krieg in Vietnam zu finanzieren. De Gaulle schickte sogar ein Kriegsschiff nach New York, um das französische Gold abzuholen.
Vertrauensbruch und Systemwechsel
zu den flexiblen Wechselkursen
1971 – auf dem Höhepunkt des Vietnam-Krieges – gab US-Präsident Nixon bekannt, dass er das «Goldfenster» schliessen werde. Das heisst, die USA würden ihren Dollar nicht mehr gegen Gold eintauschen, wie sie es nach dem Zweiten Weltkrieg versprochen hatten. Das war das Ende der Währungsordnung von Bretton Woods mit festen Wechselkursen. Die Schweiz war am 23. Januar 1973 das erste Land, das den Wechselkurs freigab. Der Dollar-Kurs sank in der Schweiz von 4,37 bis gegen 1,35. Die SNB erlitt zwar grosse Verluste auf den Dollars. Sie waren aber bei weitem gedeckt durch das Gold und die stillen Reserven.
Es war ein Schock für die Wirtschaft weltweit. Die Konjunktur brach in praktisch allen Ländern ein. In der Schweiz gingen 300 000 Arbeitsplätze verloren. Die FED versuchte die Konjunktur wieder mit einer Geldschwemme und tiefen Zinsen zu stimulieren, was aber vor allem die Inflation anheizte. Es kam zu einer Stagflation. Die Wirtschaft stagnierte und gleichzeitig stieg die Inflation – in den USA bis weit in den zweistelligen Bereich. – Was tun?
Paul Volcker wurde 1978 in den USA als Vorsitzender der amerikanischen Notenbank FED gewählt. Es gelang ihm, den US-Dollar auch ohne Goldbindung wieder ein Stück zu stabilisieren und als neue Art von Leitwährung zu etablieren: Er erhöhte die Zinsen – ebenfalls bis in den zweitstelligen Bereich. Zudem gelang es der US-Regierung, mit Saudi-Arabien ein Abkommen zu schliessen. Das Öl sollte ausschliesslich in Dollar gehandelt werden. So bekam der US-Dollar indirekt wieder eine materielle Stütze. Als Gegenleistung versprach die Regierung militärischen Schutz. Der Petrodollar als eine neue Art von Leitwährung ohne Gold war damit geboren. Der Dollar-Kurs stieg wieder an, und es gelang, die Zinsen und den Währungskurs zu normalisieren und die Wirtschaft innert weniger Jahre wieder einigermassen in normale Bahnen zu lenken. Der Aufwertungsdruck auf dem Schweizerfranken liess nach.
Das Gold weiterhin
als Garant der Unabhängigkeit
Das Gold der Schweiz funktionierte in den siebziger Jahren wie ein Bannwald, der in den Bergen die Bevölkerung vor Lawinen schützt. Es waren mit dem Gold genügend strategische Reserven vorhanden, und kein Politiker kam auf die Idee, es anzurühren, so wie in den Bergen niemand auf die Idee kommt, einen Bannwald abzuholzen.
In der Jubiläumsschrift der SNB aus dem Jahre 1981 kommt dies deutlich zum Ausdruck:
- «[…] vor allem aus drei Gründen war der SNB an der Wahrung der Rolle des Goldes gelegen: das Gold erschien als Garant fester Wechselkurse; mit der Bindung an das Gold – und nicht wie viele andere Währungen an den Dollar – schien die politische Unabhängigkeit der Schweizer Währung gewährleistet; und das Gold war Symbol für die Solidität einer Währung.»
- «Obwohl das Gold alle wesentlichen monetären Funktionen verloren hatte, betrachtete die Nationalbank den Goldbestand als ein wertvolles Aktivum; sein steigender Marktwert gestattete ihr in den späten siebziger Jahren, die hohen Kursverluste auf den Dollar-Beständen aufzufangen.» (S. 237/238)
Attacke auf die Schweiz aus den USA und
Verkauf des grössten Teils der Goldreserven
Das änderte sich in den 1990er Jahren. Die Schweiz wurde aus den USA kampagnenartig angegriffen. Die Schweizerbanken hätten viele Milliarden nachrichtenlose Vermögen aus dem Zweiten Weltkrieg in ihren Tresoren, behaupteten die Angreifer. Das Gold brachten sie mit den Nazis in Verbindung. – Es war eine üble Geschichte. Später kamen Angriffe auf das Bankkundengeheimnis dazu. Der Bundesrat beauftragte eine Kommission, die Vorwürfe zu untersuchen. Der ehemalige FED-Präsident Paul Volcker hatte den Vorsitz. Die aufwendige Aktion kostete mehr als eine Milliarde Franken. – Die Kommission fand zwar nachrichtenlose Vermögen aus dem Zweiten Weltkrieg von ungefähr 50 Millionen Franken. Die beiden Grossbanken zahlten 1,8 Milliarden Franken an Holocaust-Überlebende.
Gleichzeitig behaupteten Politiker im Inland, ein grosser Teil des Goldes sei überschüssig, könne verkauft und der Erlös verteilt werden. In der neuen Bundesverfassung von 2000 erhielt die SNB den Auftrag, einen Teil der Währungsreserven in Gold zu halten. Die SNB verkaufte 2003/07 1600 Tonnen Gold gegen US-Dollars zu den damaligen Tiefstpreisen von zum Teil unter 300 Dollar die Unze – mit der Begründung, diese Goldreserven seien überschüssig. Als ob die SNB nicht schon genug US-Dollar in ihrer Bilanz hatte! Mengenmässig entsprach das verkaufte Gold ziemlich genau dem Gold, das die Nachkriegsgeneration in den fünfziger und Anfang der sechziger Jahren erarbeitet hatte. Die SNB machte damit einen grossen Schritt in Richtung Abhängigkeit vom US-Dollar, die das Volk in den beiden Abstimmungen von 1949 und 1951 noch hatte vermeiden wollen.
Merkwürdig ist nicht nur, dass die SNB das Gold ohne Not zu Tiefstpreisen verkauft hat. Ihr Verhalten gibt zu weiteren Fragen Anlass: Das Gold der Nachkriegsgeneration war Volksvermögen, das auf Grund von zwei Volksabstimmungen erworben wurde. In der direkt-demokratischen Schweiz hätte das Volk zwingend gefragt werden müssen, ob es mit dem Verkauf einverstanden sei. Das ist nicht geschehen. Dies war ein folgenschwerer Sündenfall. Wäre dies geschehen, wären das Gold und auch die stillen Reserven mit grosser Wahrscheinlichkeit noch da, was in der heutigen Situation zweifellos hilfreich wäre.
Im Jahr 2002 wurde zwar abgestimmt: aber nicht über den Verkauf des Goldes, sondern über die Verwendung des Erlöses. Zwei Vorschläge lagen auf dem Tisch: a) Geld für den Bund, die Kantone und die Solidaritätsstiftung oder b) alles Geld für die Altersvorsorge. Das Volk stimmte bei beiden Vorschlägen deutlich mit Nein und protestierte damit, dass es in der zentralen Frage «Verkauf» oder «Nichtverkauf» übergangen wurde. (Die SNB verteilte schliesslich die Milliarden nach ihren Regeln für die Gewinnverteilung – ohne Volksabstimmung: 1/3 für den Bund und 2/3 für die Kantone.)
Es stellen sich weitere Fragen. Warum hat die SNB ihren Standpunkt geändert? 1981 bezeichnete sie das erworbene Gold im Jahresbericht noch als «wertvolles Aktivum» und als «Symbol für die politische Unabhängigkeit und Solidität der Währung». Nur einige Jahre später wurde das gleiche Gold als «überschüssig» eingestuft. Wie ist dieser Gesinnungswandel zustande gekommen? Insbesondere die Nachkriegsgeneration ist zu dieser Frage legitimiert, hat sie doch das Gold erarbeitet.
Schweizerfranken
als sicherer Hafen – damals und heute
Die Vorgänge in der Schweiz wurden auch vom Ausland beobachtet, und mancher kam auf die Idee, in der Schweiz ein Konto zu eröffnen. Insbesondere als bekannt wurde, dass nicht mehr der US-Dollar so gut wie Gold war, sondern der Schweizerfranken. Besonders die Bevölkerung in Deutschland war und ist sensibel auf den Werterhalt des Geldes – was gut zu verstehen ist –, hatte sie doch schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrer eigenen Landeswährung.
Problematisch wurde es allerdings, als der Schweizerfranken mehr und mehr zum Objekt von Spekulanten wurde, die im System der flexiblen Wechselkurse auf seine Aufwertung wetteten. Und sie hatten Grund dazu: Der Schweizerfranken wertete sich zum Beispiel in den Jahren 1977/78 gegenüber den 15 wichtigsten Handelswährungen um 40 Prozent auf. Die Schweiz wurde richtig teuer. Der Wechselkurs wurde zum Problem für den Tourismus und die Exportindustrie. Was tun?
Die SNB baute ein Abwehrdispositiv gegen die hereinströmenden ausländischen Währungen. Bereits in den sechziger Jahren verzichtete sie auf eine Verzinsung und erhob moderate Negativzinsen von 1 Prozent – ganz ähnlich wie in neuerer Zeit. Das genügte bei weitem nicht. Später errichtete sie notrechtlich Kapitalverkehrskontrollen. Wollten Spekulanten Schweizerfranken erwerben, mussten sie anfänglich zwei, dann acht und später sogar zwölf und mehr Prozent Negativzinsen bezahlen. Das Volk unterstützte die SNB in zwei Volksabstimmungen. Dabei war es für die Verantwortlichen nicht immer einfach, Spekulationsgelder vom normalen Geschäftsverkehr abzugrenzen.
Heute
Das Gold der Nachkriegsgeneration ist weg. Nach der Finanzkrise von 2008 zeigte es sich, dass der Schweizerfranken den Status als sicheren Hafen nicht verloren hatte. Auch wenn das Restgold heute in der Bilanz der SNB nur noch eine geringe Rolle (etwa sieben Prozent) spielt, wertete sich der Schweizerfranken gegenüber den meisten Währungen auf. Auch die Turbulenzen um die CS haben dem Status als sicherer Hafen nichts anhaben können. Die politische Stabilität der Schweiz, eine wettbewerbsfähige und diversifizierte Wirtschaft, der strukturelle Überschuss im Aussenhandel, die soliden Staatsfinanzen und die tiefe Inflation zählen nach wie vor zu den gewichtigsten Trümpfen. Es hat sich zudem gezeigt, dass sich in der Schweiz die zahlreichen regional verankerten Genossenschafts- und Kantonalbanken auch im heutigen System ganz gut zurechtfinden – die global orientierten Grossbanken dagegen weniger.
Die SNB hat erneut ein Abwehrdispositiv errichtet, weil sich ähnliche Fragen stellen wie in den 1970er Jahren. Die SNB verlangte bis vor kurzem Negativzinsen und errichtete auch einen Mindestkurs für den Euro von 1,20, den sie später wieder aufgab (ganz ähnlich wie der Mindestkurs für die D-Mark im Jahr 1978). Aber sie errichtete keine Kapitalverkehrskontrollen. Sie kaufte die hereinströmenden Euros, Dollars usw. und bezahlte mit neu kreierten Schweizerfranken. Sie kaufte mit den Devisen deutsche und amerikanische Staatsanleihen und erwarb auch ausländische Aktien. Ihre Bilanz wuchs so von Jahr zu Jahr von hundert zu zweihundert Milliarden … bis zu einer Billion Schweizerfranken. Auch mit dieser Politik will sie verhindern, dass der Schweizerfranken zu stark wird und die Exporte behindert. Inflation gibt es deswegen praktisch nicht, weil die neu geschaffenen Schweizerfranken – oft als Notpfennig – auf den Konten im Bankensystem bleiben.
2022 ist es der SNB nicht gelungen, den Kursverfall der wichtigsten Währungen und auch die Verluste an den ausländischen Börsen zu kompensieren, so dass ein riesiger Verlust von 132 Milliarden Franken resultierte. Die Leitung der SNB wäre wahrscheinlich froh, wenn das Gold und die stillen Reserven der Nachkriegsgeneration noch da wären. Die Politik der SNB erscheint für den Laien abenteuerlich. Euro und Dollar haben wegen der Inflation noch weiteres Abwärtspotential, weil die Inflation in Deutschland und in den USA höher ist als in der Schweiz. Vielleicht würde es Sinn machen, gezielt wieder Kapitalverkehrskontrollen einzuführen, wetten doch die Hedgefonds mit riesigen Geldbeträgen auf die Auf- oder Abwertung einer Währung. Bekannt ist zum Beispiel George Soros, der in den 1990er Jahren mit Milliarden auf die Abwertung des englischen Pfunds gewettet hatte (und Erfolg hatte).
Erstaunlich ist, dass der starke Schweizerfranken die Exportindustrie gesamthaft nicht geschwächt, sondern eher gestärkt hat. Unternehmer haben im Hinterkopf, dass sie damit rechnen müssen, dass die wichtigsten Währungen wie der Euro und der Dollar stetig schwächer werden und dass sie sich besonders anstrengen müssen, um diesen Nachteil zu kompensieren. Der Euro hat seit seiner Gründung im Jahr 1999 gegenüber dem Schweizerfranken etwa 40 Prozent verloren. Der Dollar hat seit Bretton Woods etwa 80 Prozent verloren, das britische Pfund 90 Prozent.
Alternativen zum Dollar-System
Die Instabilität gehört zum heutigen flexiblen Geld- und Währungssystem. Es kam immer wieder zu Krisen: zum Beispiel die grosse Schuldenkrise der Entwicklungsländer in den 1980er Jahren (ausgelöst durch den Zinsanstieg der FED), die Japan-Krise, die Asien-Krise, die Russland-Krise, die Dotcom-Krise, die Immobilienkrise in den USA von 2008 … und heute die Vertrauenskrise. Jede dieser Krisen hat ihre eigenen Ursachen. Im Hintergrund steht jedoch die systemische Instabilität des Geldsystems (mit flexiblen Wechselkursen). Beunruhigend ist heute das Ausmass und die Zunahme der privaten und öffentlichen Verschuldung in vielen Ländern. Die «Notenpresse» bzw. die Geldschwemme gehört zur Politik. Nur zu oft saugen die FED und die EZB Schulden auf wie mit einem Staubsauger und bringen so neu «gedrucktes» Geld im Umlauf. Die Kriegsfinanzierung über die «Notenpresse» ist auch heute aktuell.
Heute sind die Notenbanken in der Zwickmühle. Erhöhen sie die Zinsen, gibt es Schwierigkeiten im Bankensystem und in der Wirtschaft. Erhöhen sie die Zinsen nicht, kann die Inflation ihre destruktive Wirkung entfalten.
Die USA haben vor einigen Monaten die Dollar-Reserven von Russland eingefroren, obwohl sie sich mit diesem Land offiziell gar nicht im Krieg befinden. Zuvor ist es Afghanistan ähnlich ergangen. Manche Länder werden sich überlegen, wie sie sich aus der Abhängigkeit vom Dollar lösen können. Wie Medienmeldungen zu entnehmen ist, bereiten die BRICS-Länder eine Alternative zum Dollar-System vor, die mit Gold und Rohstoffen unterlegt sein soll. Bereits eingeleitet ist das Ende des Petrodollars. Mehr und mehr werden das Öl und andere Güter auch in Landeswährungen wie dem chinesischen Yuan gehandelt. Die Welt soll multipolarer werden. Ob hier das Geschäftsmodell einer global ausgerichteten Schweizer Grossbank noch hineinpasst? – Man kann gespannt sein. •
1 Binswanger, Mathias. Geld aus dem Nichts, Wie Banken Wachstum ermöglichen und Krisen verursachen. Wiley 2015
Literatur:
Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz, Geschichte der freiheitlich-demokratischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz. Verlag Zeit-Fragen, Zürich 2020